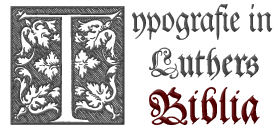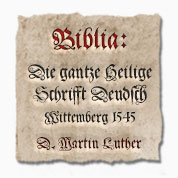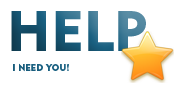Das Buch der Psalmen
Psalm XXVIII.

Die Lutherbibel von 1545
Die Texte der Lutherbibel von 1545 in Frakturschrift
Das Alte Testament
Die Bücher der Dichtung

Die gantze Heilige Schrifft Deudsch
D. Martin Luther, Wittenberg 1545
Der Psalter
Die Bücher der Psalmen
XXVIII.
Ps 28,1-9
150 Psalmen, aufgeteilt in fünf Büchern
Bitte und Dank
Psalm 28, 5%2C
Im folgenden Text ist der bezeichnete Vers hervorgehoben.
Der Pſalter.
XXVIII.
1Ein Pſalm Dauids.
WEnn ich ruff zu dir HERR mein Hort / ſo ſchweige mir nicht / Auff das nicht / wo du ſchweigeſt / ich gleich werde denen / die in die Helle faren.
2Höre die ſtim meines flehens / wenn ich zu dir ſchreie / Wenn ich meine hende auffhebe / zu deinem heiligen Chor.
3Zeuch mich nicht hin / vnter den Gottloſen / vnd vnter den Vbelthetern / Die freundlich reden mit jrem Neheſten / Vnd haben böſes im hertzen.
4Gib jnen nach jrer that / vnd nach jrem böſen weſen / Gib jnen nach den wercken jrer hende / Vergilt jnen was ſie verdienet haben.
5Denn ſie wöllen nicht achten auff das Thun des HERRN / noch auff die werck ſeiner Hende / Darumb wird er ſie zebrechen vnd nicht bawen.
6Gelobet ſey der HERR / Denn er hat erhöret die ſtim meines flehens.
7DEr HERR iſt meine Stercke vnd mein Schild / Auff jn hoffet mein hertz / vnd mir iſt geholffen / Vnd mein hertz iſt frölich / vnd ich wil jm dancken mit meinem Lied.
8Der HERR iſt jre ſtercke / Er iſt die ſtercke die ſeinem Geſalbeten hilfft.
9HJlff deinem Volck / vnd ſegene dein Erbe / Vnd weide ſie / vnd erhöhe ſie ewiglich.
❦
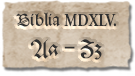
Wörterbuch zur Lutherbibel
Wörtersuche
Gesuchtes Luther-Wort eingeben:
Die Liste aller der Schlagwörter im Wörterbuch findet sich im ![]() Register.
Register.
Worterklärungen: Übersicht
Die folgenden Begriffe aus dem Text Ps 28 werden hier erläutert.
Versnummer: Luthers Wort | |||
1: Pſalm Dauids | 1: HERR | 1: Helle | |
2: ſchreie | 2: hende | 2: heiligen | |
3: Zeuch mich | 3: Gottloſen | 3: Vbelthetern | |
3: Neheſten | 4: Vergilt | 5: das Thun | |
5: zebrechen | 5: bawen | 6: ſey | |
8: Geſalbeten | |||
Klick auf ein Wort führt zum Eintrag mit den Erklärungen. Das vollständige Verzeichnis findet sich hier: | |||
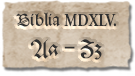
Aus dem Wörterbuch
Worterklärungen:
Seltene Namen, Wörter und Begriffe im Text Ps 28
Luther-Deutsch | Deutsch | Erläuterungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pſalm Dauids | Psalm Davids Angabe der Urheberschaft im Titel von 50 Psalmen:
Die Formulierung besagt nicht verlässlich, dass David selbst diese Psalmen verfasst hat. Sie bedeutet wohl nur, dass sie zu einer Sammlung von Psalmen gehören, die ihm gewidmet ist. In der Lutherbibel von 1545 benennen 73 Psalmen in der Überschrift David als Urheber.
a)
b) Psalmen 16, 56, 57, 58, 59 und 60
c) Psalmen 32, 52, 53, 54, 55 und 142
d) Psalmen 122, 124, 131 und 133
e) Psalmen 68 und 108
f) Psalmen 17 und 86
g) Psalm 7
h) Psalm 145
i) Psalm 138
Zur Person Davids
Historisch kreisen um die Person Davids viele ungeklärte Fragen. Nach der biblischen Überlieferung war David nach Saul der zweite König Israels und lebte von etwa 1000 bis 961 v. Chr. Genauere Lebensdaten sind unbekannt.
David war zunächst Musiker am Hof Sauls und wurde später Offizier in seinem Heer.
Die Geschichte Davids wird ausführlich erzählt in den beiden Samuelbüchern (
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERR | HERR, JHWH, Jahwe Aussehen in unseren Frakturschriften: HERR oder HERR
HERR im Alten Testament
hebräisch: יהוה (jhwh, das Tetragrammaton JHWH) lateinisch (Biblia Sacra Vulgata): Dominus, Herr
Luthers Schreibweise HERR in Versalien (Großbuchstaben) folgt einer festen Regel. Sie weist darauf hin, dass im hebräischen Text an dieser Stelle das Tetragrammaton (das Vierfachzeichen) »JHWH« (hebr.: יהוה) steht. Es ist der unaussprechliche Name Gottes.
Satztechnisch bedingte Varianten
Um beim Satz der Lettern Platz in einer Zeile zu sparen, wodurch übermäßiger Sperrdruck oder ungünstige Wortumbrüche vermieden werden, sind in der Lutherbibel von 1545 häufig auch die Varianten HERr oder HERRn oder HERrn zu finden. Dabei sind mindestens die ersten drei Zeichen in Versalien gesetzt, womit sie hinreichend von HErr unterscheidbar sind.
An wenigen Stellen im Text wurde eine für uns unübliche Trennung im Wort vorgenommen, um einen Zeilenumbruch zu realisieren, hier beispielhaft gezeigt:
[ ...] fur den HER- RN bringen [...]
HERR HErr
Der Ausdruck HERR HErr steht dann, wenn im hebräischen Text »JHWH Adonaj« zu lesen ist. (Siehe dazu auch den Artikel
Auch die umgekehrte Reihenfolge HErr HERR ist möglich (»Adonaj JHWH«).
4bSo ſpricht der HErr HERR / 5aſie gehorchen oder laſſens /
Die neuen Lutherbibeln übersetzen diesen Ausdruck stets mit »Gott der HERR«.
Die Aussprache des Namens Gottes
Das Wissen um die Aussprache der vier Zeichen, die den Gottesnamen ausmachen, ist schon früh in der Geschichte verloren gegangen. Sie werden heute oft mit »Jahwe« (vokalisiert geschrieben יְהוָה nach der Aussprache des hebräischen Adonaj, Herr) oder »Jehova« (יְהוָֹה ebenfalls nach dem hebräischen Adonaj, Herr, jedoch unter Berücksichtigung aller Vokale) transkribiert, aber auch mit »Jewah« (ebenfalls יְהוָה aber nach dem hebräischen Schema, der Name, zu lesen) oder »Jehowih« (יְהוִה nach dem hebräischen Elohim, Gott / Götter).
Luthers Namensersatz
Luther kannte die vokalisierten Varianten und die transkribierten Formen und war wohl besonders dem Wort »Jehova« zugeneigt. Es bezieht alle drei Vokale aus dem Wort Adonaj, das »Herr« bedeutet. Dennoch hatte er es vermieden, in seiner Übersetzung »Jehova« zu verwenden. Stattdessen nutzte er wie die lateinischen Bibeln einen Wortersatz. Er setzte das deutsche Wort ein, das gemäß der jüdischen Tradition zu lesen sei, wenn im Text das Vierfachzeichen erscheint, machte es aber durch die besondere Satzweise in Großbuchstaben kenntlich: HERR.
Luthers Schreibweise hat sich bis heute in etlichen Bibelausgaben gehalten.
HERR im Neuen Testament
Im neuen Testament verwendet Luther die Schreibweise HERR in Versalien (Großbuchstaben) für Gott, den Vater, an Stellen, wo sich Zitate aus dem Alten Testament auf »JHWH« beziehen.
Wichtig: Davon zu unterscheiden sind die Schreibweisen
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helle | Hölle, die
Totenreich, das Helle
hebräisch: שאול (Scheol), lateinisch: infernum, auch: abyssus, baratrum, loca inferna, loca infernorum griechisch: Ἅδης (Hades). das Totenreich
Gedacht als konkreter Ort unter der Erdoberfläche (im Gegensatz zum Himmel über der Erdoberfläche), zu dem die Toten hinabsteigen.
Ort der Toten, Totenreich, in Abgrenzung zum Ort (zur Welt) der Lebenden.
Bedeutung
Der Begriff Hölle ist schwierig und zwischenzeitlich längst mystisch verklärt als Ort der Qual für die nach dem Tode Verdammten, als Ort des Feuers, wo Pech und Schwefel brennen, als Ort der Sünder, die aufgrund ihrer irdischen Verfehlungen Höllenpein zu erleiden haben, usw. Derartige Inhalte sind mit dem hebräischen Begriff Scheol nicht verbunden!
Moderne Übersetzungen vermeiden daher meist das Wort Hölle, um nicht einem nichtbiblischen und unchristlichen Glauben an einen verklärten Ort der Qualen, der Dämonen und Teufel Vorschub zu leisten.
Herrscher über den Scheol ist der Gott JHWH (s.
Auch Jesus ist nach seinem Tod zunächst in den Hades hinabgestiegen (Glaubensbekenntnis).
Häufig werden daher heute statt Hölle Begriffe wie Totenreich oder Ort der Toten o. ä. verwendet.
Das Wort Helle im Psalter der Lutherbibel
meint: Die Gottlosen sollten sterben
meint: die Gottlosen müssen zum Schweigen gebracht werden durch einen schändlichen Tod
meint: sie liegen in ihren Gräbern wie Schafe und der Tod nagt an ihnen
meint: sie müssen in ihren Gräbern bleiben
meint: Gott wird meine Seele vor der Macht des Todes retten
meint: Der Tod mag sie einholen und mitten aus dem Leben reißen
meint: bewahre mein Leben vor dem Tod
meint: ich sieche dahin und bin dem Tode nahe, oder: ich fühle mich, als würde ich sterben
meint: ich werde genauso wenig geachtet wie Verstorbene
meint: der sein Leben bewahrt
meint: im Grab ist es still und alles ist aus.
meint: Der Tod umklammert mich und Todesangst hat mich überwältigt
meint: führe ich in den Himmel: du bist da! Begäbe ich mich ins Totenreich: Da bist du auch!
meint: Die Leiber und Knochen unserer Verwundeten und Toten sind <über das ganze Feld> verstreut
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ſchreien | schreien (Verb) sehr laut reden, sprechen ich ſchreie
Höre die ſtim meines flehens / wenn ich zu dir ſchreie
Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie.
JCh ſchreie mit meiner ſtim / zu Gott / Zu Gott ſchreie ich / vnd er erhöret mich.
Ich schreie mit meiner Stimme zu Gott. Zu Gott schreie ich, und er erhört mich. ich ſchrey
Das »e« am Ende entfällt. Das »ei« am Wortende wird nach den Regeln des Luther-Deutsch zu »ey«.
Luther verwendet ſchrey sowohl als Präsensform wie auch als Präteritum.
Wenn mir angſt iſt / ſo ruffe ich den HERRN an / vnd ſchrey zu meinem Gott
Wenn ich Angst habe, rufe ich den HERRN an und schreie zu meinem Gott.
Dennoch höreteſtu meines flehens ſtim / da ich zu dir ſchrey.
Dennoch hörtest Du das Flehen in meiner Stimme, als ich zu dir schrie.
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hand
Hende | Hand, die
Hände, die
Mein Gebet müſſe fur dir tügen / wie ein Reuchopffer / Meine hende auffheben / wie ein Abendopffer.
Mein Gebet soll dir erscheinen wie ein Rauchopfer, das Erheben meiner Hände wie ein Abendopfer.
Nimm mein Gebet als Rauchopfer und das Erheben meiner Hände als Abendopfer.
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heilig | heilig (Adjektiv) (In Abgrenzung zum Irdischen:) göttlich vollkommen und verehrungswürdig.
Das Adjektiv kommt häufig vor in den Verbindungen:
u.a.
Ort, Boden:
Er ſprach / Trit nicht herzu / zeuch deine ſchuch aus von deinen Füſſen / Denn der Ort / da du auffſteheſt / iſt ein heilig land.
Er [GOTT] sprach: »Komme nicht näher! Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen! Denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land.«
Tätigkeiten:
Das iſts / das der HERR geſagt hat / Morgen iſt der Sabbath der heiligen ruge des HERRN /
Das ist es, was der HERR gesagt hat: »Morgen ist der Sabbat der heiligen Ruhe des HERRN.«
Gegenstände:
Vnd ſolt Aaron deinem Bruder heilige Kleider machen / die herrlich vnd ſchön ſeien.
Und [ihr] sollt Aaron, deinem Bruder, heilige Kleider machen, die herrlich und schön seien.
Menschen:
Vnd jr ſolt mir ein prieſterlich Königreich / vnd ein heiliges Volck ſein.
Und ihr sollt mir ein priesterliches Königreich und ein heiliges Volk sein.
GOTT:
[...] vnd ſprachen / Heilig / heilig / heilig iſt der Gott der HERR / der Allmechtige / der da war / vnd der da iſt / vnd der da kompt.
[...] und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist der Gott, der HERR, der Allmächtige, der da war, und der da ist, und kommt und da sein wird.
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zeuchen | zeuchen (Verb; veraltet) zeucheln (Verb; veraltet) ziehen (Verb) ziehen (in jeglichem Sinn), zerren, raffen.
er zoch: er zog (3.Pers. Prä.)
Vnd zoch mich aus der grawſamen Gruben
Und zog mich aus der grausamen Grube
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottloſe
Gotloſe | Gottlose, der Substantivierung von:
Religiöser Begriff, der die Existenz Gottes voraussetzt:
1) Zustand: los von Gott; von Gott los [sein]; von Gott verlassen; ohne Gott. 2) religiöse Grundhaltung: Gott nicht dienend; die Ehre, den Willen, die Gebote Gottes missachtend
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vbelthetter
Vbeltheter | Übeltäter, der jemand, der Übel anrichtet, der etwas Schlechtes getan hat, der gegen ein Gesetz oder Gebot (hier: die Gesetze und Gebote Gottes) handelt.
Zeuch mich nicht hin / vnter den Gottloſen / vnd vnter den Vbelthetern / Die freundlich reden mit jrem Neheſten / Vnd haben böſes im hertzen.
Ziehe mich nicht weg gemeinsam mit den Gottlosen und den Übertätern, die mit ihrem Nächsten freundlich reden, aber Böses im Sinn haben.
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neheſte | Nächste, der bürgerlich: Nachbar, der im biblischen Gebrauch: Mitmensch, der
Das Wort »der Nächste« ist der substantivische Superlativ von »nah«.
Der Nächste in den 10 Geboten
Heute ist der Begriff »der Nächste« veraltet. Er wird überwiegend nur noch im biblisch-religiösen Kontext verwendet und sonst fast nur noch als unbestimmte Angabe für eine Reihenfolge, z. B. in Arztpraxen (»Der Nächste, bitte!«).
Wir empfehlen daher stattdessen Wörter wie »Nachbar«, »Mitmensch« oder auch »anderer Mensch« (o. ä.) zu probieren, wo immer es geht.
Damit wären auch recht einfach das 8. und 9. Gebot (
8. Gebot: »Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen gegen andere Menschen.«
9. Gebot: »Du sollst nicht begehren das Haus anderer Menschen.«
Das 10. Gebot stellt uns vor besondere Herausforderungen: Wer hat heute noch »Knechte« (ein Begriff aus Luthers Zeit, im Text eigtl.: Sklaven), Mägde (eigtl.: Sklavinnen), Rind und Esel?
Übertragen auf unsere Zeit geht es um ein Unternehmen: Es geht um Arbeiter (Knechte und Mägde) und um Produktionsgüter (Rind und Esel) – denn das waren sie schon zur alttestamentlichen Zeit, nur nannte man sie nicht so. Es ließe sich formulieren:
10. Gebot: Du sollst nicht begehren die Frau eines anderen, auch nicht sein Geschäft, seine Arbeit, seine Arbeiter oder seinen Besitz.
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vergelten | vergelten (Verb) ursprünglich: empfangenes Geld zurückbezahlen (in vergelten steckt das Wort Gelt, Geld).
a) bezahlen, zurückzahlen b) Ersatz leisten für etwas, eine Gegenleistung für etwas erbringen Formen:
er vergilt ihnen: er vergilt ihnen (3. Person Singular Präsens Aktiv Indikativ) er vergelte ihnen: er vergelte ihnen (3. Person Singular Präsens Aktiv Konjunktiv)
Vergilt jnen was ſie verdienet haben.
a) Vergilt ihnen, was sie verdient haben. b) Zahle ihnen zurück, was sie verdient haben.
Wol dem der dir vergelte / wie du vns gethan haſt.
a) Wohl dem, der dir vergelte, wie du uns getan hast. b) Wohl dem, der dir vergelten möge, was du für uns getan hast. c) Wohl dem, der dir bezahle, was du für uns getan hast.
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thun | Tun, das Substantivisch gebrauchter Infinitiv von
1) das Tätigsein, das Handeln, das Machen, das Verhalten von jemandem 2) das Benehmen, das Betragen, der Umgang 3) mit einem Anwesen oder einem Amt verbundenes Geschäft
Denn ſie wöllen nicht achten auff das Thun des HERRN / noch auff die werck ſeiner Hende
a) Denn sie wollen weder auf die Taten des HERRN achten noch auf die Werke seiner Hände. b) Denn sie wollen weder Gottes Handeln respektieren noch die Ergebnisse seiner Arbeit.
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zerbrechen
zebrechen
zubrechen | zerbrechen (Verb) etwas vollständig, gänzlich brechen
1) Gegenstände, Gerätschaften: in Stücke brechen 2) Speisen (wie z. B. Brot): brechen 3) Steine, Erze: in Stücke brechen, zerstoßen 4) Gebäude, Bauten, Anlagen: niederreißen, einreißen, zum Einsturz bringen 5) Körper und Glieder von Menschen oder Tieren: in Stücke teilen 5) Menschlicher Geist, Wille: den Willen brechen
Hinweis: Luther verwendet ohne Unterscheidung:
Die Vorsilben »ze(r)-« und »zu(r)-«
Zur Verwendung der Vorsilben »zer«, »ze«, »zur« und »zu« in der Lutherbibel von 1545 siehe den Artikel:
Denn ſie wöllen nicht achten auff das Thun des HERRN / noch auff die werck ſeiner Hende / Darumb wird er ſie zebrechen vnd nicht bawen.
Denn sie wollen weder die Taten des HERRN respektieren noch die Werke seiner Hände. Deshalb wird er sie [ihren Geist, ihre Absichten] brechen und nicht aufbauen [gedeihen lassen, bestärken, fördern].
Zubrich den arm des Gottloſen
Zerbrich den Arm der Gottlosen
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bawen | bauen (Verb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ſey | er/sie/es sei (Verb) von: sein (Verb) Das »ei« am Wortende wird nach den Regeln des Luther-Deutsch zu »ey«.
Es werde eine Feſte zwiſchen den Waſſern / vnd die ſey ein Vnterſcheid zwiſchen den Waſſern.
Es werde ein Himmelsgewölbe zwischen den Gewässern, und das sei die Trennung zwischen den Gewässern.
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geſalbte
Geſalbete | Gesalbte, der Mensch, der durch Salbung geweiht und geheiligt ist.
1. Nach biblischer Sitte bezeichnet der Begriff Könige. U. a. beinhaltet das Ritual der Krönung die Salbung mit wertvollen Ölen.
2. »Der Gesalbte« bezeichnet den Messias, den von den Juden erwarteten mächtigen König: Wir haben den Messias funden (welches ist verdolmetscht der Gesalbete) (Joh 1,14).
Der Gesalbte: - hebräisch: משיח, Messias - in griechischer Transkription: Μεσσίας, Messias - ins Griechische übersetzt: Χριστός, Christos - latinisiert: Christus.
3. Ein Gesalbter ist ein Eingeweihter, einer der mit den Geheimnissen einer Gesellschaft, eines Bundes u. s. w. bekannt ist.
Bezeichnung für den König
Der ſeinem Könige gros Heil beweiſet vnd wolthut ſeinem Geſalbeten / Dauid vnd ſeinem Samen ewiglich.
Der seinem König große Hilfe erweist, der seinem Gesalbten Gutes tut, David und allen seinen Nachkommen
SK Version 14.02.2026 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterungen siehe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

™Hinweise zur Stilkunst.de-Ausgabe
Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Bibeltextes
Der Text aus der Lutherbibel ist auf unseren Seiten in Anlehnung an das Druckbild des Originals von 1545 wiedergegeben.
Den Seitenaufbau, die verwendeten Schriften, die Schreibregeln der Frakturschrift und Luthers Intentionen, mit der Typografie Lesehilfen bereitzustellen, erläutert dem interessierten Leser unser Artikel »Satz und Typografie der Lutherbibel von 1545«.