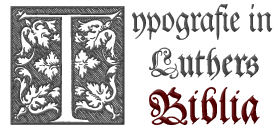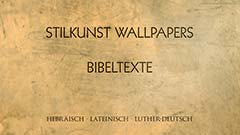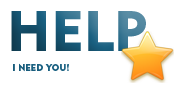Gründonnerstag
Donnerstag, 14. April 1960

QuickInfo
Nach eisenacher Ordnung | |
| Evangelium | |
| Predigt | |
Nach lutherischer Ordnung | |
| Evangelium | |
| Predigt | |
In den Landeskirchen gelten unterschiedliche Textordnungen (s. u.).
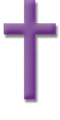
Das evangelische Kirchenjahr

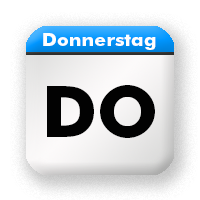
Gründonnerstag
Weiß
Tag der Einsetzung des heiligen Abendmahls
Fastenzeit
Der Gründonnerstag in den Kirchenjahren 1959/1960 bis 1966/1967
Verweise führen zu den Kalenderblättern des jeweiligen Datums:

- Christlicher Gedenktag
- Donnerstag vor
 Ostern
Ostern - Abhängig vom
 Osterdatum
Osterdatum
Gründonnerstag liegt zwischen dem 19. März und dem 22. April eines Jahres

- 3 Tage vor Ostern
- gerechnet ab diesem Tag ist am 4. Tag Ostern

Gesetzlicher Feiertag
Der Gründonnerstag ist kein allgemein ![]() gesetzlicher Feiertag. In Baden-Württemberg (BW) haben Schüler per Feiertagsgesetz an diesem Tag schulfrei. Allerdings fällt der Tag regelmäßig in die Osterferien.
gesetzlicher Feiertag. In Baden-Württemberg (BW) haben Schüler per Feiertagsgesetz an diesem Tag schulfrei. Allerdings fällt der Tag regelmäßig in die Osterferien.
Stiller Tag
Die Feiertagsgesetze der Länder erklären den Gründonnerstag zu einem stillen Tag, an dem besondere Beschränkungen gelten. Die Beschränkungen können in den einzelnen Ländern unterschiedlich festgelegt sein.
So sind am Gründonnerstag in Hessen von 04:00 Uhr (morgens) an für den Rest des Tages öffentliche Tanzveranstaltungen verboten. (Hessisches Feiertagsgesetz, §10).
Wissenswertes zum Tag
 Gründonnerstag 1960
Gründonnerstag 1960
Zu Gründonnerstag gehört die Geschichte vom Letzten Abendmahl. Wir erklären das jüdische Pascha-Ritual und wie es von Jesus im Abendmahl umgesetzt wurde.
Der Name Gründonnerstag
Ein unbekannter Name
Seit dem 12. Jahrhundert ist die Bezeichnung »Gründonnerstag« für den Gedenktag der Einsetzung des Abendmahls (de coena domini) bekannt. Woher der Name stammt und welche Bedeutung er besaß, ist bis heute ungeklärt. Alle Versuche, den deutschen Namen zu enträtseln, stützen sich auf vage, unbelegte Ableitungen und befriedigen nicht.
Fest steht aber, dass bereits in der alten Kirche der Donnerstag der Karwoche als Gedenktag der Einsetzung des Abendmahls und als Gedenktag an die Vorgänge des Tages vor der Kreuzigung Jesu gefeiert wurde.
Die mittelalterlichen Bezeichnungen
Feria Quinta in Coena Domini
Für den Gründonnerstag gab es zahlreiche Bezeichnungen. Die lateinisch-kirchliche Bezeichnung Feria Quinta in Coena Domini bedeutet »Fünfter Tag, im Gedenken an das Abendmahl des Herrn«.
Feria quinta ist die mittelalterliche Bezeichnung für Donnerstag, den fünften Tag der Woche, wobei der Sonntag (dies dominica) der erste Tag (feria prima) ist.
Der Name lässt sich somit auch lesen als: Fünfter Tag [der Passionswoche], Gedenktag an das Abendmahl des Herrn.
Dies Coenae Dominicae
Die lateinische Bezeichnung Dies Coenae Domincae bedeutet »Tag des Abendmahls des Herrn« und meinte »den nächsten donnerstag fur Ostern«, Gründonnerstag. (![]() Sehling, EVKO-08/1, S.308 Sp.2.)
Sehling, EVKO-08/1, S.308 Sp.2.)
Coena Domini
Die lateinische Bezeichnung Coena Domini bedeutet »(Nacht-)Mahl des Herrn«. Sie entspricht unserer Kurzbezeichnung »Abendmahl« – und bedeutet als Kalenderdatum den Tag des Abendmahls, Gründonnerstag.
Das Triduum Sacrum
Die drei österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung des Herrn
Der Abend des Gründonnerstags mit der Abendmahlsfeier und als Vorabend des Karfreitags war lange Zeit und ist wieder Teil des Triduum Sacrum. Informationen und Erläuterungen dazu finden sich in diesem Artikel:
Wissenswertes
 Triduum
Triduum
Die Begriffe »Triduum Sacrum« und »Triduum Paschale« bezeichnen katholische Feste. Doch was bedeuten sie? Der Artikel gibt Antworten.
Die alten Namen und Bezeichnungen der Sonntage, Festtage und Feiertage entstammen alten Kirchenordnungen, Perikopenordnungen, Gesangbüchern und insbesondere ![]() H.Grotefend, Zeitrechnung. Siehe auch unser
H.Grotefend, Zeitrechnung. Siehe auch unser ![]() Quellenverzeichnis.
Quellenverzeichnis.
Gottesdienstliche Ordnung

Der evangelische
Gründonnerstag
Tag der Einsetzung des heiligen Abendmahls
Donnerstag vor Ostern
gültig in den Kirchenjahren von 1957/1958 bis 1977/1978
Liturgische Farbe
Weiß
Wir zeigen in den Kirchenjahren ab 1898/1899 bis 1977/1978 die in jener Zeit maßgeblichen Leseordnungen.
Im Kirchenjahr 1959/1960 galten bevorzugt:
- I. Altkirchliche Ordnung:
Die Ordnung für Landeskirchen, die nach wie vor der altkirchlichen Textordnung folgten (so die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg). - II. Eisnacher Ordnung:
Die Ordnung für Landeskirchen, die den Empfehlungen der Eisenacher Konferenz folgten (so die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau). - III. Ordnung der Lutherischen Liturgischen Konferenz Deutschlands:
Die Ordnung für Landeskirchen, die der Textordnung der Lutherischen Liturgischen Konferenz Deutschlands folgten.
In den Jahren vor 1978/1979 wurden die Perikopenordnungen der evangelischen Kirchen nicht einheitlich gestaltet.
Neben etlichen Entwürfen und Erprobungen der lutherischen Kirchen speziell in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hielten sich die Perikopenordnungen nach dem Schema der altkirchlichen Ordung und nach der Empfehlung der Eisenacher Konferenz (1896) überwiegend in unierten und reformierten Landeskirchen bis zum Kirchenjahr 1977/1978.
Dagegen empfahl die Lutherische Liturgische Konferenz Deutschlands 1957 den lutherischen Landeskirchen eine neue Textordnung auf Basis von sechs Reihen.
Erst mit der Revision, die eine Ordnung der Predigttexte ab 1978/1979 vorsah, vereinheitlichte sich die Nutzung der Perikopen in den Landeskirchen weitgehend, aber längst nicht vollständig.
Gottesdienstliche Ordnung
I.
Nach altkirchlicher Textordnung
gültig bis 1977/1978
Thema des Sonntags
( nach dem Evangeliumstext Joh 13,1-15 )
Die Fußwaschung
Psalm für den Tag
Hinweis: Es gilt der Wochensspruch des vorgehenden Sonntags.
Lied für den Tag
| EG alt | EG neu | Titel |
|---|---|---|
| 154 | EG 215 | Jeſus Chriſtus, unsſer Heiland, der von uns den Gotteszorn wandt |
EG: Evangelisches Gesangbuch
EG alt: Nummer des Liedes in alten Evangelischen Gesangbüchern
EG neu: Nummer des Liedes im neuen Evangelischen Gesangbuch (ab 2013)
Die biblischen Texte für Lesung und Predigt
| Lesung | Text für die Lesung |
|---|---|
| Epistel | |
| Evangelium | |
Erläuterungen zu den Perikopen
Mit der Reformation änderte sich die Bedeutung der Lesungen und der Predigt im Gottesdienst grundlegend. Gab es vorher keine oder nur eine sehr lose Bindung der Perikopen an die Messe, so war für Luther nun regelmäßig die Evangelienperikope Grundlage der Predigt im sonntäglichen Hauptgottesdienst (vormittags), an diesem Tag also ![]() Joh 13,1-15.
Joh 13,1-15.
Im Fokus der Predigt stand jetzt als Teil der Verkündigung die Auslegung des Evangeliums.
Die Epistelperikope war als Predigttext empfohlen für den Gebrauch im Gottesdienst am Nachmittag bzw. Abend (siehe dazu auch Luthers Schrift ![]() Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde, 1523, Über den Sonntagsgottesdienst).
Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde, 1523, Über den Sonntagsgottesdienst).
Die Reihe der Epistelperikopen enthielt (anders als heute) auch Texte aus dem Alten Testament. Es gab keine spezielle Reihe für Lesungen aus dem Alten Testament.
Doch die Pfarrer und Prediger waren zunächst nicht nur frei darin, einen biblischen Text für die Predigt zu wählen, sondern geradezu aufgefordert, die Predigt an den Bedürfnissen der Gemeinde und an der geübten Praxis auszurichten.
In den meisten Kirchen wurden nahezu täglich Gottesdienste geboten (die in unseren Kalendern z. Z. nicht abgebildet sind). An Sonn- und Feiertagen konnten gleich mehrere Gottesdienste und Messen stattfinden. Hier entwickelten sich Leseempfehlungen für jeden Wochentag, in Summe also für jeden Tag des Kirchenjahres.
Von Bedeutung war auch die protestantische Ausrichtung der Gebietskirche: lutherisch, reformiert (calvinistisch) und uniert. Unterschiede zeigten sich in der Liturgie und damit im Verständnis der Predigt als Teil der Verkündigung.
Luthers allgemeinen Empfehlungen in seinen Schriften folgten etwa ab 1560 vereinzelt Ansätze, eine gewisse verbindliche Textordnung für Pfarrer und Gemeinden zu gestalten. Dies geschah jedoch zaghaft und zögerlich angesichts der bestehenden Meinungsvielfalt und angesichts der Lage der Entscheidungshoheit, die nicht in der Kirche, sondern beim Landesfürsten angesiedelt war. Zunächst gab es auch keinen hinreichenden Bedarf für neue Regelungen: Gottesdienst war selbstverständlich und die Bevölkerung nahm rege teil. Doch spätestens im Zeitalter der Aufklärung, als ein deutlicher Rückgang christlichen Engagements in der Bevölkerung zu erkennen war, die Zahl der Gottesdienstbesucher stetig abnahm und etliche unterwöchige Gottesdienste und Messen gestrichen wurden, trat die Notwendigkeit deutlich hervor, das Gottesdienstverständnis und die Gottesdienste des Kirchenjahres zu überdenken.
Dies führte vielfach schon früh und speziell im 19. Jahrhundert zu zahlreichen unterschiedlichen Durchführungen, Vorschlägen und Erprobungen, bis sich 1896 die Eisenacher Konferenz als reichsweite Konferenz der deutschen Landeskirchen mit der Idee einer allgemein gültigen Textordnung beschäftigte und schließlich eine Perikopenordnung beschloss, die ab 1898/1899 allen evangelischen Landeskirchen zur Umsetzung empfohlen wurde.
Es ist derzeit an dieser Stelle nicht möglich, für die Jahre 1530/1531 bis 1898/1899 Textordnungen darzustellen, die über die altkirchlichen Perikopen für die Lesungen und Predigten hinaus gehen. Wir sind uns dabei bewusst, dass diese Perikopen regional und zeitlich begrenzt keine Bedeutung hatten.
II.
Textordnung der Eisenacher Konferenz
bevorzugt in unierten und reformierten Landeskirchen
gültig in den Jahren 1898/1899 bis 1977/1978
Spruch und Psalm für den Tag
Er hat ein Gedechtnis geſtifftet ſeiner Wunder / Der gnedige vnd barmhertzige HERR.
Lied für den Tag
| EG alt | EG neu | Titel |
|---|---|---|
| 154 | EG 215 | Jeſus Chriſtus, unsſer Heiland, der von uns den Gotteszorn wandt |
EG: Evangelisches Gesangbuch
EG alt: Nummer des Liedes in alten Evangelischen Gesangbüchern
EG neu: Nummer des Liedes im neuen Evangelischen Gesangbuch (ab 2013)
Die biblischen Texte für Lesung und Predigt
| Reihe | Inhalt | Text für die Predigt |
|---|---|---|
| Reihe I: altkirchliche Reihe | Epistel | |
| Evangelium | ||
| Reihe II | 2. Epistel | |
| 2. Evangelium | ||
| alttestamentliche Reihe | Alttestamentliche Perikope | |
Aufbau der Leseordnung
Die Eisenacher Konferenz (eine Konferenz der evangelischen Landeskirchen Deutschlands) erarbeitete in den Jahren von 1888 bis 1896 eine Perikopenordnung für die evangelischen Kirchen. Sie verstand die altkirchlichen Perikopen (Epistel und Evangelium) als eine erste Reihe und fügte ihnen in einer zweiten Reihe einen zweiten Text aus den Episteln und einen zweiten Text aus den Evangelien hinzu. Die große Besonderheit dieser Ordnung war die Einführung einer dritten, alttestamentlichen Reihe, die für jeden Sonntag des Kirchenjahres erstmals einen alttestamentlichen Text bot. Die Verwendung dieser Perikopen geschah nicht einheitlich. Gedacht waren sie dazu, sie wechselweise im Gottesdienst zu verwenden, so innerhalb einer Folge von vier Jahren:
- im 1. Jahr: altkirchliches Evangelium und altkirchliche Epistel
- im 2. Jahr: 2. Evangelium und Lektion Altes Testament
- im 3. Jahr: altkirchliches Evangelium und altkirchliche Epistel
- im 4. Jahr: 2. Evangelium und 2. Epistel
Damit ergab sich für die Lesungen ein Zyklus von vier Jahren und für die Predigt, die sich jeweils auf die Evangelienperikope stützte, ein Zyklus von zwei Jahren.
Altkirchliche Textordnung in Landeskirchen
In einigen Landeskirchen, darunter die evangelische Kirche Brandenburgs, galt in dieser Zeit weiterhin die altkirchliche Textordnung. Sie kennt nur Evangelium und Epistel (Reihe I in der Eisenacher Textordnung), die beide nach wie vor für die Textlesung sowie für die Predigt im Haupt- und Abendgottesdienst empfohlen waren.
Die evangelische Kirche Württembergs
Die evangelische Kirche Württembergs nutzte in dieser Zeit eine Perikopenordnung, die sich auf einen Dreijahreszyklus stützte. Über die drei Jahrgänge hinweg fanden sich die Perikopen wie hier genannt, allerdings in anderer Anordnung und ergänzt um weitere Perikopen, die weder in altkirchlichen Ordnungen noch in der neuen Eisenacher Ordnung bekannt waren.
Diese Ordnung der evangelischen Kirche Württembergs ist derzeit hier nicht wiedergegeben.
Geschichtliche Anmerkungen: Die Eisenacher Perikopen in Zeiten des Umbruchs
- In den Jahren des nationalsozialistischen Regimes gab es im Zusammenhang mit der brachialen antisemitischen Ausrichtung in Politik und Gesellschaft in den evangelischen Kirchen regional Intentionen, die alttestamentliche Reihe abzuschaffen und die anderen Reihen im Sinne einer Staatsräson zu korrigieren. Dieses Ansinnen wirkte trotz einer Bekennenden Kirche vereinzelt bis weit die Zeit nach dem 2. Weltkrieg nach.
- Auch nach der Vereinigung von Landeskirchen, wie der Gründung von VELKD und EKD, blieben die Ordnungen der Predigttexte den Synoden der Landeskirchen unterworfen und entwickelten sich somit zunehmend uneinheitlich.
- Dies hatte zur Folge, dass es in den Jahren zwischen etwa 1950 und 1958 speziell in den lutherischen Landeskirchen auf der Suche nach einem neuen evangelischen Gottesdienst- und Predigtverständnisses zahlreiche unterschiedliche Perikopenordnungen gab. Die Fülle von kleinen Änderungen und großen Erprobungen im Rahmen der Vorbereitung einer einschneidenden Revision (wie der Einführung eines Sechs-Reihen-Modells, erprobt ab 1952/1953) ist hier nicht darstellbar.
- Ab dem Jahr 1957/1958, spätestens ab 1960/1961 galt dann in den meisten evangelisch-lutherischen Kirchen eine neue Perikopenordnung auf Basis von sechs Reihen, weil sich nun erstmals nach Eisenach über Jahre hinweg eine landeskirchlich übergreifende und unabhängige Konferenz (Lutherische Liturgische Konferenz Deutschlands) mit liturgisch-homiletischen Fragen beschäftigte und 1957 Antworten in Form einer »Ordnung der Predigttexte« vorlegte.
- Doch die Entscheidungshoheit oblag nach wie vor den landeskirchlichen Synoden. Überwiegend unierte und reformierte Landeskirchen nutzten die hier vorliegende Ordnung der Predigttexte nach dem Eisenacher Schema weiterhin bis 1977/1978 oder auch darüber hinaus.
- Bis heute gilt in manchen evangelischen Kirchen und Freikirchen eine Ordnung auf Grundlage der Eisenacher Perikopen im vierjährigen Zyklus.
III.
Textordnung der
Lutherischen Liturgischen Konferenz Deutschlands
(1957)
bevorzugt in lutherischen Landeskirchen
gültig in den Jahren 1957/1958 bis 1977/1978
Spruch und Psalm für den Tag
Er hat ein Gedechtnis geſtifftet ſeiner Wunder / Der gnedige vnd barmhertzige HERR.
Lied für den Tag
| EG alt | EG neu | Titel |
|---|---|---|
| 154 | EG 215 | Jeſus Chriſtus, unsſer Heiland, der von uns den Gotteszorn wandt |
EG: Evangelisches Gesangbuch
EG alt: Nummer des Liedes in alten Evangelischen Gesangbüchern
EG neu: Nummer des Liedes im neuen Evangelischen Gesangbuch (ab 2013)
Die biblischen Texte für die Lesungen
| Lesung | Text für die Lesung |
|---|---|
| Evangelium | |
| Epistel | |
Die biblischen Texte für die Predigt
| Kirchen- jahr | Datum | Reihe | Texte für die Predigt | Marginaltexte (M | C | PS) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959/1960 | 14.4.1960 | VI | | PS | |
| 1960/1961 | 30.3.1961 | I | M | | |
| 1961/1962 | 19.4.1962 | II | M | | |
| 1962/1963 | 11.4.1963 | III | M | | |
| 1963/1964 | 26.3.1964 | IV | |||
| 1964/1965 | 15.4.1965 | V | |||
Datum:
Unsere Sortierung stellt jeweils das gewählte Jahr nach oben. Die Spalte »Datum« zeigt das tatsächliche Datum des Tages, für den der Predigttext gilt.
Reihen:
Die Perikopenordnung kennt ab dem Kirchenjahr 1957/1958 zwei Lesetexte (je einen aus den Evangelien und einen aus den Episteln) sowie sechs Predigttextreihen.
Die Reihen werden mit römischen Zahlen von I bis VI gekennzeichnet. Jede Reihe benennt die Bibeltexte (Perikopen) für alle Predigten in einem Kirchenjahr zwischen dem 1. Advent und dem letzten Sonntag des Kirchenjahres. Die Reihen gelten nacheinander. Sie umfassen somit die Zeitspanne von sechs Kirchenjahren.
Diese Ordnung beginnt mit Reihe IV für das Kirchenjahr 1957/1958. Die Reihe I gilt für das Kirchenjahr 1960/1961, die Reihe II für das Kirchenjahr 1961/1962 usw. Die Gültigkeit dieser Ordnung endet 1977/1978 mit Reihe VI.
Marginaltexte (M) sind Texte, die thematisch gut zum Tag passen. aber keinen Platz in den Reihen fanden. Aus ihnen kann die Gemeinde unabhängig von Reihe und Kirchenjahr einen Text für die Predigt wählen, der dann den vorgesehenen Predigtext der gültigen Reihe ersetzt.
Continua-Texte (C) sind Marginaltexte, die ein biblisches Buch oder wesentliche Teile daraus fortlaufend über mehrere Sonntage hinweg für die Predigt bieten.
Psalter-Texte (PS) sind zusätzliche Lesetexte aus dem Psalter, der ansonsten nicht in den Predigtreihen vorkommt. Sein Ort ist traditionell der Tages- oder Wochenspalm, der Hallelujavers und ggf. der Spruch. Der Psalmtext kann auch für die Predigt genutzt werden. Dann taucht er mit der Kennung »M« (für marginalen Predigtext) ggf. ein zweites Mal in der Liste auf. Er sollte dann an die Stelle der in in den Reihen vorgesehenen alttestamentlichen Perikope treten.
Aufbau der Leseordnung
Die wesentlichen Neuerungen dieser Textordnung sind:
- Neben der Evangelienperikope stehen nun auch die Epistelperikope und i. d. R. 6 weitere Texte (ggf. mehr) für die Predigt innerhalb eines Zykluses bereit.
- Der Zyklus umfasst sechs Jahre, in denen sich die Predigten nicht wiederholen.
Die Reihen folgen einem vorgegebenen Format:
- Reihe I ist stets der Evangelientext für die Lesung.
- Reihe II ist stets der Episteltext für die Lesung.
- In den Reihen III bis VI kommt mindestens eine alttestamentliche Perikope vor.
In der Regel werden für jeden Sonntag zwei (oder mehr) so genannte »Marginaltexte« (M) geboten. Hier hat die Gemeinde (bzw. der Prediger) die Entscheidungsmöglichkeit zwischen dem Text der jeweils gültigen Reihe oder einem der Marginaltexte.
Eine besondere Form des Marginaltextes ist der Continuatext (C), der auf eine lange Tradition zurückblicken kann: An mehreren Sonntagen hintereinander werden für die Predigt Texte geboten, die ein ganzes biblisches Buch umfassen (Jona) oder wesentliche Teile daraus.
Eine weitere Besonderheit ist die zusätzliche Reihe der Psalterperikopen (PS). Texte aus den Psalmen dienen nicht nur als Eingangs- (Introitus), Wochen-oder Tagespsalm, sie können nun auch für die Predigt genutzt werden. Diese Reihe ist bevorzugt als Option gedacht für das jeweilige Jahr, in dem die alttestamentliche Perikope gilt.
»Frewet euch mit den Frölichen /
vnd weinet mit den Weinenden.
Habt mit allen Menſchen Friede.«
Zum Gebrauch
Für die inhaltliche und thematische Gestaltung der Gottesdienste schlagen die Ordnungen der evangelischen Kirchen seit Jahrhunderten biblische Texte vor.
Die hier gebotenen Texte folgen einer Kirchenordnung, die heute nicht mehr gültig ist!
Bitte rufen Sie den Kirchentag im aktuellen Jahr auf, wenn Sie wissen möchten, welche Bibelstellen für Lesungen und Predigt nach der gültigen Kirchenordnung für den Gottesdienst empfohlen werden.

™Hinweise zur Stilkunst.de-Ausgabe
Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Bibeltextes
Der Text aus der Lutherbibel ist auf unseren Seiten in Anlehnung an das Druckbild des Originals von 1545 wiedergegeben.
Den Seitenaufbau, die verwendeten Schriften, die Schreibregeln der Frakturschrift und Luthers Intentionen, mit der Typografie Lesehilfen bereitzustellen, erläutert dem interessierten Leser unser Artikel »Satz und Typografie der Lutherbibel von 1545«.
Wissenswertes zum Tag
 Gründonnerstag 1960
Gründonnerstag 1960
Zu Gründonnerstag gehört die Geschichte vom Letzten Abendmahl. Wir erklären das jüdische Pascha-Ritual und wie es von Jesus im Abendmahl umgesetzt wurde.
Infos. Fakten. Wissen.
 Wann ist Ostern?
Wann ist Ostern?
Die beweglichen Feiertage im Jahreslauf hängen ab vom Osterdatum. Der Artikel erläutert, wie sich das Osterdatum berechnet und nennt die aktuellen Daten der Feiertage.
Bildschirmhintergründe
 Wallpapers Bibeltexte
Wallpapers Bibeltexte
Bildschirmhintergründe für ihren Monitor mit Texten und Sprüchen in Luther-Deutsch aus Luthers Biblia von 1545, einige davon zusätzlich in Hebräisch und Latein.