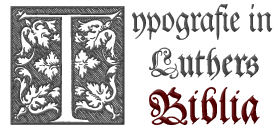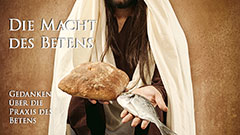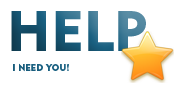Buß- und Bettag
Mittwoch, 19. November 1800

QuickInfo
Altkirchliche Ordnung
| Evangelium | |
| Epistel | |
| Lied | Nr. 195 [EG 299] |
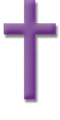
Das evangelische Kirchenjahr
nach den altkirchlichen Leseordnungen
Der Buß- und Bettag in den Kirchenjahren 1799/1800 bis 1806/1807
Verweise führen zu den Kalenderblättern des jeweiligen Datums:

- Buß- und Bettag
- immer ein Mittwoch
- eineinhalb Wochen vor dem
 1. Advent
1. Advent - abhängig vom Wochentag, auf den der
 1. Weihnachtstag fällt
1. Weihnachtstag fällt - der Buß- und Bettag liegt
zwischen dem 16. November und dem 22. November eines Jahres

- 32 bis 38 Tage vor dem
 Christfest
Christfest
A
llgemeine Informationen und Gedanken zu diesem Tag finden Sie in diesem Artikel:
Wissenswertes zum Tag
 Buß- und Bettag 1800
Buß- und Bettag 1800
Martin Luther forderte in seinen 95 Thesen zur Buße auf. Zum Buß- und Bettag gehört die Erinnerung an dieses evangelische Grundverständnis.
Gottesdienstliche Ordnungen

Der evangelische
Buß- und
Bettag
nach der altkirchlichen Leseordnung
![]() allgemein seit der Reformation mindestens bis zum Kirchenjahr 1897/1898 in Gebrauch
allgemein seit der Reformation mindestens bis zum Kirchenjahr 1897/1898 in Gebrauch
Liturgische Farbe
Violett
Thema des Sonntags
( nach dem Evangeliumstext Lk 13,1-9 )
Bußpredigt Jeſu über den Untergang der Galiläer.
Gleichnis vom Feigenbaum
Psalm für den Tag
Hinweis: Es gilt der Wochenspruch des vorgehenden Sonntags.
Die biblischen Texte für Lesung und Predigt
| Lesung | Predigttext | Text |
|---|---|---|
| Evangelium | im Hauptgottesdienst | |
| Epistel | im zweiten Gottesdienst | |
Erläuterungen zu den Perikopen
Mit der Reformation änderte sich die Bedeutung der Lesungen und der Predigt im Gottesdienst grundlegend. Gab es vorher keine oder nur eine sehr lose Bindung der Perikopen an die Messe, so war für Luther nun regelmäßig die Evangelienperikope Grundlage der Predigt im sonntäglichen Hauptgottesdienst (vormittags), an diesem Tag also ![]() Lk 13,1-9.
Lk 13,1-9.
Im Fokus der Predigt stand jetzt als Teil der Verkündigung die Auslegung des Evangeliums.
Die Epistelperikope war als Predigttext empfohlen für den Gebrauch im Gottesdienst am Nachmittag bzw. Abend (siehe dazu auch Luthers Schrift ![]() Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde, 1523, Über den Sonntagsgottesdienst).
Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde, 1523, Über den Sonntagsgottesdienst).
Die Reihe der Epistelperikopen enthielt (anders als heute) auch Texte aus dem Alten Testament. Es gab keine spezielle Reihe für Lesungen aus dem Alten Testament.
Doch die Pfarrer und Prediger waren zunächst nicht nur frei darin, einen biblischen Text für die Predigt zu wählen, sondern geradezu aufgefordert, die Predigt an den Bedürfnissen der Gemeinde und an der geübten Praxis auszurichten.
In den meisten Kirchen wurden nahezu täglich Gottesdienste geboten (die in unseren Kalendern z. Z. nicht abgebildet sind). An Sonn- und Feiertagen konnten gleich mehrere Gottesdienste und Messen stattfinden. Hier entwickelten sich Leseempfehlungen für jeden Wochentag, in Summe also für jeden Tag des Kirchenjahres.
Von Bedeutung war auch die protestantische Ausrichtung der Gebietskirche: lutherisch, reformiert (calvinistisch) und uniert. Unterschiede zeigten sich in der Liturgie und damit im Verständnis der Predigt als Teil der Verkündigung.
Luthers allgemeinen Empfehlungen in seinen Schriften folgten etwa ab 1560 vereinzelt Ansätze, eine gewisse verbindliche Textordnung für Pfarrer und Gemeinden zu gestalten. Dies geschah jedoch zaghaft und zögerlich angesichts der bestehenden Meinungsvielfalt und angesichts der Lage der Entscheidungshoheit, die nicht in der Kirche, sondern beim Landesfürsten angesiedelt war. Zunächst gab es auch keinen hinreichenden Bedarf für neue Regelungen: Gottesdienst war selbstverständlich und die Bevölkerung nahm rege teil. Doch spätestens im Zeitalter der Aufklärung, als ein deutlicher Rückgang christlichen Engagements in der Bevölkerung zu erkennen war, die Zahl der Gottesdienstbesucher stetig abnahm und etliche unterwöchige Gottesdienste und Messen gestrichen wurden, trat die Notwendigkeit deutlich hervor, das Gottesdienstverständnis und die Gottesdienste des Kirchenjahres zu überdenken.
Dies führte vielfach schon früh und speziell im 19. Jahrhundert zu zahlreichen unterschiedlichen Durchführungen, Vorschlägen und Erprobungen, bis sich 1896 die Eisenacher Konferenz als reichsweite Konferenz der deutschen Landeskirchen mit der Idee einer allgemein gültigen Textordnung beschäftigte und schließlich eine Perikopenordnung beschloss, die ab 1898/1899 allen evangelischen Landeskirchen zur Umsetzung empfohlen wurde.
Es ist derzeit an dieser Stelle nicht möglich, für die Jahre 1530/1531 bis 1898/1899 Textordnungen darzustellen, die über die altkirchlichen Perikopen für die Lesungen und Predigten hinaus gehen. Wir sind uns dabei bewusst, dass diese Perikopen regional und zeitlich begrenzt keine Bedeutung hatten.
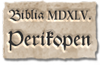
Perikopen nach Luther 1545
Buß- und Bettag
Perikopen
Texte für Lesungen und Predigt
Texte nach der Lutherbibel von 1545 gesetzt nach der Vorlage des Originals in Frakturschrift mit Luthers Scholion und Verweisen in den Marginalspalten. Ergänzt um Verszählung und Abschnittsüberschriften.
LESUNG AUS DEM EVANGELIUM
PREDIGTTEXT
Evangelium
Evangelium nach Lukas
Lk 13,1-9
Text hören:
Sprecher: R. Makohl | Musik: ©Bluevalley, J.S. Bach
Das Verzeichnis der Hörbuch-Videos mit den Lesungen des Evangeliums finden Sie hier:
![]() ↦ Video-Hörbuch
↦ Video-Hörbuch

Euangelium
S. Lucas.
C. XIII.
Verse 1 - 5
Der Untergang der Galiläer und
der Turm von Siloah
ES waren aber zu der ſelbigen zeit etliche dabey / die verkündigeten Jheſus von den Galileern / welcher blut Pilatus ſampt jrem Opffer vermiſchet hatte. 2Vnd Jheſus antwortet / vnd ſprach zu jnen / Meinet jr / das dieſe Galileer fur allen Galileern ſünder geweſen ſind / die weil ſie das erlidden haben? 3Ich ſage / nein / Sondern ſo jr euch nicht beſſert / werdet jr alle auch alſo vmbkomen. 4Oder meinet jr / das die achzehen / auff welche der Thurn in Siloha fiel / vnd erſchlug ſie / ſeien ſchüldig geweſen / fur allen Menſchen / die zu Jeruſalem wonen? 5Ich ſage / nein / Sondern ſo jr euch nicht beſſert / werdet jr alle auch alſo a vmbkomen.
a
(Umbkomen)
Die Jüden hieltens dafür / wem es zeitlich wolgienge / der were fur Gott angeneme. Vnd widerumb wo es jm vbel gienge / ſo were er ein Sünder.
Verse 6 - 9
Das Gleichnis vom Feigenbaum
IHeſus ſaget jnen aber dieſe Gleichnis / Es hatte einer ein Feigenbawm / der war gepflantzt in ſeinem Weinberge / vnd kam vnd ſuchte Frucht darauff / vnd fand ſie nicht. 7Da ſprach er zu dem Weingartner / Sihe / Ich bin nu drey jar lang / alle jar komen / vnd habe Frucht geſucht auff dieſem Feigenbawm / vnd finde ſie nicht / Hawe jn ab / was hindert er das Land? 8Er aber antwortet / vnd ſprach zu jm / Herr / Las jn noch dis jar / bis das ich vmb in grabe / vnd betünge jn / 9ob er wolte Frucht bringen / Wo nicht / So hawe jn darnach abe.
![]()
✽
LESUNG UND ZWEITER PREDIGTTEXT
Epistel
Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom
Rom 2,1-11
REIHE
EP

Die Epiſtel S. Pauli:
An die Römer.
C. II.
Verse 1 - 11
Schuld und Ehre vor Gott, ohne Ansehen der Person
Paulus schreibt:
DARumb / o Menſch / kanſtu dich nicht entſchüldigen / wer du biſt / der da richtet. Denn worinne du einen andern richteſt / verdamſtu dich ſelbs / Sintemal du eben daſſelbige thuſt / das du richteſt. 2Denn wir wiſſen / das Gottes vrteil iſt recht vber die / ſo ſolchs thun. 3Denckeſtu aber / o Menſch / der du richteſt die / ſo ſolches thun / vnd thuſt auch dasſelbige / das du dem vrteil Gottes entrinnen werdeſt? 4Oder verachteſtu den reichthum ſeiner güte / gedult vnd l langmütigkeit? Weiſſeſtu nicht / das dich Gottes güte zur Buſſe leitet?
l
(Langmütigkeit)
Auff latiniſch tardus jra / vnd iſt dem Ebreiſchen nachgeredt / Arich Appaim.
Vnd iſt eine Tugent eigentlich die langſam zürnet vnd ſtraffet das vnrecht. Aber Gedult iſt / die das vbel tregt an gut / leib vnd ehre / ob es gleich mit recht geſchehe. Güte iſt die leibliche wolthat vnternander / vnd freundliches weſen.
5DV aber nach deinem verſtockten vnd vnbuſfertigen Hertzen / heuffeſt dir ſelbſt den zorn auff den tag des zorns vnd der offenbarung des gerechten gerichtes Gottes / 6Welcher geben wird einem jglichen nach ſeinen wercken / 7nemlich / Preis vnd ehre / vnd vnuergenglichs weſen / denen / die mit gedult in guten wercken trachten nach dem ewigen Leben / 8Aber denen / die da zenckiſch ſind / vnd der warheit nicht gehorchen / gehorchen aber dem vngerechten / Vngnade vnd zorn / 9trübſal vnd angſt / vber alle Seelen der Menſchen / die da böſes thun / fürnemlich der Jüden vnd auch der Griechen. 10Preis aber / vnd ehre vnd friede / allen denen / die da gutes thun / furnemlich den Jüden vnd auch den Griechen.
11DEnn es iſt kein anſehen der perſon fur Gott / 12Welche on Geſetz geſündiget haben / Die werden auch on Geſetz verloren werden / Vnd welche am Geſetz geſündiget haben / die werden durchs Geſetz verurteilet werden. 13Sintemal fur Gott nicht die das Geſetz hören / gerecht ſind / Sondern die das Geſetze thun / werden gerecht ſein. 14Denn ſo die Heiden / die das Geſetz nicht haben / vnd doch * von natur thun des Geſetzes werck / dieſelbigen / dieweil ſie das Geſetze nicht haben / ſind ſie jnen ſelbs ein Geſetz / 15damit / das ſie beweiſen / des Geſetzes werck ſey beſchrieben in jrem hertzen / Sintemal jr Gewiſſen ſie bezeuget / da zu auch die gedancken / die ſich vnternander verklagen oder entſchüldigen / 16auff den tag / da Gott das verborgen der Menſchen / durch Jheſum Chriſt / richten wird / lauts meines Euangelij.
*
(Von natur)
Das natürliche Geſetz iſt / Was du wilt dir gethan vnd vberhaben ſein von einem andern / das thu vnd vberhebe du auch einen andern. Darinnen das gantze Geſetz Moſi begriffen iſt / wie Chriſtus ſagt / Math. 7. An welchem Geſetz die Heiden auch nicht mehr denn das euſſerliche werck thun / wie die Jüden an Moſes Geſetz. Vnd das verklagen vnd entſchüldigen iſt / das eine ſünde gröſſer iſt / denn die andere / wider das Geſetz.
![]()
✽
1) Langmütigkeit: Luther beschreibt, dass er aus seinen Quellen den lateinischen Begriff tardus ira (dt.: »langsamer Zorn«, »säumige Erbitterung«, o. ä.) mit Langmütigkeit übersetzt ( d. i.: »lange gutmütig, geduldig« im Ggs. zu schnell wütend, ungeduldig). Er sieht damit die Begriffe »Geduld« und »Güte« verbunden.
Der lateinische Begriff wiederum sei eine Nachbildung (keine Übersetzung) des hebräischen Ausdrucks »Arich Appaim«.
Luther transkribiert die hebräische Wendung אַפָיִם אֹרֶךְ , (»ˀorεk ˀapͻjim«), die »langmütig« oder substantiviert »Geduld« bedeutet.
Nach Luthers Meinung entspricht sein eingedeutschter Begriff eher dem hebräischen Ausdruck, weil der eine Tugend bezeichne und keine situative Stimmungslage.
Die Anmerkung erläutert einerseits den Begriff, andererseits richtet sich Luther an die Kritiker seiner Übersetzung, die sich auf lateinische Quellen und Bibelausgaben berufen, weshalb er lateinisches und transkribiertes hebräisches Vokabular bemüht.
Der Untergang der Galiläer,
der Turm von Siloah und
das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum (Lk 13,1-9).
Hörbuch-Video zur Biblia 1545
 Hörbuch-Video: Lk 13,1-9
Hörbuch-Video: Lk 13,1-9
Das Video zeigt den Text der Geschichte vom Untergang der Galiläer und dem Turm von Siloah sowie das Gleichnis vom Feigenbaum aus der Lutherbibel von 1545, vorgelesen von Reiner Makohl.
»Frewet euch mit den Frölichen /
vnd weinet mit den Weinenden.
Habt mit allen Menſchen Friede.«
Zum Gebrauch
Der Rückblick auf die Perikopenordnungen vergangener Jahrhunderte zeigt auf, wie sich die Verwendung der biblischen Texte in evangelischen Gottesdiensten im Laufe der Zeit veränderte.
Wir beschränken uns in den weit zurückliegenden Jahren auf Perikopenordnungen, die überwiegend in Gebrauch waren.
Durch die neue Ordnung für die Verwendung von Sprüchen, Psalmen, Bibeltexten und Liedern in Gottesdiensten sind die alten Ordnungen zwar liturgisch überholt, aber inhaltlich deswegen keineswegs falsch.
Wir möchten Sie daher ermuntern, die in alter Zeit verwendeten Perikopen zu betrachten. Nur so können Sie ergründen, ob das, worauf sich Pfarrer vor Hunderten von Jahren in Gottesdienst und Predigt stützten, auch noch heute aktuell ist. Aktuell für Sie ganz persönlich.

™Hinweise zur Stilkunst.de-Ausgabe
Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Bibeltextes
Der Text aus der Lutherbibel ist auf unseren Seiten in Anlehnung an das Druckbild des Originals von 1545 wiedergegeben.
Den Seitenaufbau, die verwendeten Schriften, die Schreibregeln der Frakturschrift und Luthers Intentionen, mit der Typografie Lesehilfen bereitzustellen, erläutert dem interessierten Leser unser Artikel »Satz und Typografie der Lutherbibel von 1545«.
Wissenswertes zum Tag
 Buß- und Bettag 1800
Buß- und Bettag 1800
Martin Luther forderte in seinen 95 Thesen zur Buße auf. Zum Buß- und Bettag gehört die Erinnerung an dieses evangelische Grundverständnis.
Gedankenpause
 Die Macht des Betens
Die Macht des Betens
Beten! – Was riskieren wir schon dabei? Nichts. Was kostet es uns, außer einigen Minuten Zeit, die wir vermutlich anderweitig kaum besser genutzt hätten?
Ein Workshop zum Thema Beten



/Preview-Lk_13(1-9).png)