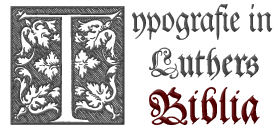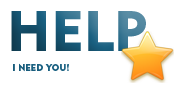Totensonntag
Sonntag, 23. November 1800
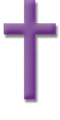
Das evangelische Kirchenjahr
nach den altkirchlichen Leseordnungen

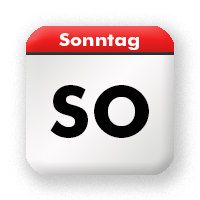
Gedenktag der Entschlafenen
Totensonntag
(24. Sonntag nach Trinitatis)
Der Totensonntag in den Kirchenjahren 1799/1800 bis 1806/1807
Verweise führen zu den Kalenderblättern des jeweiligen Datums:

- Gedenktag Totensonntag
- Am letzten Sonntag im
 Kirchenjahr
Kirchenjahr - Totensonntag ist der Sonntag vor dem
 1. Advent
1. Advent - abhängig vom Wochentag, auf den der
 1. Weihnachtstag fällt
1. Weihnachtstag fällt - der Totensonntag liegt
zwischen dem 20. und dem 26. November eines Jahres

- 29 bis 35 Tage vor dem
 Christfest
Christfest
Gottesdienstliche Ordnungen

Der evangelische
Totensonntag
Gedenktag der Entschlafenen
nach der altkirchlichen Leseordnung
![]() allgemein seit der Reformation mindestens bis zum Kirchenjahr 1897/1898 in Gebrauch
allgemein seit der Reformation mindestens bis zum Kirchenjahr 1897/1898 in Gebrauch
Liturgische Farbe
Grün
Thema des Sonntags
( nach dem Evangeliumstext Mt 25,1-13 )
Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen
Spruch und Psalm für die Woche
Die biblischen Texte für Lesung und Predigt
| Lesung | Predigttext | Text |
|---|---|---|
| Evangelium | im Hauptgottesdienst | |
| Epistel | im zweiten Gottesdienst | |
Erläuterungen zu den Perikopen
Mit der Reformation änderte sich die Bedeutung der Lesungen und der Predigt im Gottesdienst grundlegend. Gab es vorher keine oder nur eine sehr lose Bindung der Perikopen an die Messe, so war für Luther nun regelmäßig die Evangelienperikope Grundlage der Predigt im sonntäglichen Hauptgottesdienst (vormittags), an diesem Tag also ![]() Mt 25,1-13.
Mt 25,1-13.
Im Fokus der Predigt stand jetzt als Teil der Verkündigung die Auslegung des Evangeliums.
Die Epistelperikope war als Predigttext empfohlen für den Gebrauch im Gottesdienst am Nachmittag bzw. Abend (siehe dazu auch Luthers Schrift ![]() Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde, 1523, Über den Sonntagsgottesdienst).
Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde, 1523, Über den Sonntagsgottesdienst).
Die Reihe der Epistelperikopen enthielt (anders als heute) auch Texte aus dem Alten Testament. Es gab keine spezielle Reihe für Lesungen aus dem Alten Testament.
Doch die Pfarrer und Prediger waren zunächst nicht nur frei darin, einen biblischen Text für die Predigt zu wählen, sondern geradezu aufgefordert, die Predigt an den Bedürfnissen der Gemeinde und an der geübten Praxis auszurichten.
In den meisten Kirchen wurden nahezu täglich Gottesdienste geboten (die in unseren Kalendern z. Z. nicht abgebildet sind). An Sonn- und Feiertagen konnten gleich mehrere Gottesdienste und Messen stattfinden. Hier entwickelten sich Leseempfehlungen für jeden Wochentag, in Summe also für jeden Tag des Kirchenjahres.
Von Bedeutung war auch die protestantische Ausrichtung der Gebietskirche: lutherisch, reformiert (calvinistisch) und uniert. Unterschiede zeigten sich in der Liturgie und damit im Verständnis der Predigt als Teil der Verkündigung.
Luthers allgemeinen Empfehlungen in seinen Schriften folgten etwa ab 1560 vereinzelt Ansätze, eine gewisse verbindliche Textordnung für Pfarrer und Gemeinden zu gestalten. Dies geschah jedoch zaghaft und zögerlich angesichts der bestehenden Meinungsvielfalt und angesichts der Lage der Entscheidungshoheit, die nicht in der Kirche, sondern beim Landesfürsten angesiedelt war. Zunächst gab es auch keinen hinreichenden Bedarf für neue Regelungen: Gottesdienst war selbstverständlich und die Bevölkerung nahm rege teil. Doch spätestens im Zeitalter der Aufklärung, als ein deutlicher Rückgang christlichen Engagements in der Bevölkerung zu erkennen war, die Zahl der Gottesdienstbesucher stetig abnahm und etliche unterwöchige Gottesdienste und Messen gestrichen wurden, trat die Notwendigkeit deutlich hervor, das Gottesdienstverständnis und die Gottesdienste des Kirchenjahres zu überdenken.
Dies führte vielfach schon früh und speziell im 19. Jahrhundert zu zahlreichen unterschiedlichen Durchführungen, Vorschlägen und Erprobungen, bis sich 1896 die Eisenacher Konferenz als reichsweite Konferenz der deutschen Landeskirchen mit der Idee einer allgemein gültigen Textordnung beschäftigte und schließlich eine Perikopenordnung beschloss, die ab 1898/1899 allen evangelischen Landeskirchen zur Umsetzung empfohlen wurde.
Es ist derzeit an dieser Stelle nicht möglich, für die Jahre 1530/1531 bis 1898/1899 Textordnungen darzustellen, die über die altkirchlichen Perikopen für die Lesungen und Predigten hinaus gehen. Wir sind uns dabei bewusst, dass diese Perikopen regional und zeitlich begrenzt keine Bedeutung hatten.
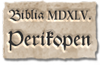
Perikopen nach Luther 1545
Totensonntag
Perikopen
Texte für Lesungen und Predigt
Texte nach der Lutherbibel von 1545 gesetzt nach der Vorlage des Originals in Frakturschrift mit Luthers Scholion und Verweisen in den Marginalspalten. Ergänzt um Verszählung und Abschnittsüberschriften.
LESUNG UND PREDIGTTEXT
Evangelium
Evangelium nach Matthäus
Mt 25,1-13
Text hören:
Sprecher: R. Makohl | Musik: ©Bluevalley, J.S. Bach
Das Verzeichnis der Hörbuch-Videos mit den Lesungen des Evangeliums finden Sie hier:
![]() ↦ Video-Hörbuch
↦ Video-Hörbuch

Euangelium
S. Mattheus.
C. XXV.
Verse 1 - 13
Das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen
Jesus sprach:
DEnn wird das Himelreich gleich ſein zehen Jungfrawen / die jre Lampen namen / vnd giengen aus dem Breutgam entgegen. 2Aber fünff vnter jnen waren töricht / vnd fünff waren klug. 3Die törichten namen jre Lampen / Aber ſie namen nicht Ole mit ſich. 4Die klugen aber namen Ole in jren gefeſſen ſampt jren Lampen. 5Da nu der Breutgam verzog / worden ſie alle ſchlefferig / vnd entſchlieffen.
6ZVr Mitternacht aber ward ein geſchrey / Sihe / der Breutgam kompt / gehet aus jm entgegen. 7Da ſtunden dieſe Jungfrawen alle auff / vnd ſchmückten jre Lampen. 8Die törichten aber ſprachen zu den klugen / Gebt vns von ewrem Ole / Denn vnſere Lampen verleſſchen. 9Da antworten die Klugen / vnd ſprachen / Nicht alſo / auff das nicht vns vnd euch gebreche / Gehet aber hin zu den Kremern / vnd keuffet fur euch ſelbs. 10Vnd da ſie hin giengen zukeuffen / kam der Breutgam / vnd welche bereit waren / giengen mit jm hin ein zur Hochzeit / Vnd die thür ward verſchloſſen. 11Zu letzt kamen auch die andern Jungfrawen / vnd ſprachen / HErr / HErr / thu vns auff. 12Er antwortet aber / vnd ſprach / Warlich ich ſage euch / Ich kenne ewer nicht. 13Darumb wachet / Denn jr wiſſet weder tag noch ſtund in welcher des menſchen Son komen wird.
(Ire Lampen)
Die Lampen on öle / ſind die guten werck on glauben / die müſſen alle verleſſchen. Das Olegefeſs aber iſt der glaube im gewiſſen auff Gottes gnade / der thut gute werck / die beſtehen. Wie aber hie das Ole keine der andern gibt / Alſo mus ein jglicher fur ſich ſelbs gleuben.
![]()
✽
LESUNG UND ZWEITER PREDIGTTEXT
Epistel
Zweiter Brief des Petrus
2Petr 3,3-14
REIHE
EP

Die Ander Epiſtel
S. Peters.
C. III.
Aus dem Abschnitt:
Die Argumentation gegen die Irrlehrer und ihre falschen Lehren
Verse 3 - 7
Petrus schreibt:
WIſſet das auffs erſt / Das in den letzten tagen komen werden / Spötter / die nach jren eigen Lüſten wandeln / 4vnd ſagen / Wo iſt die verheiſſung ſeiner Zukunfft? Denn nach dem die Veter entſchlaffen ſind / bleibet es alles / wie es von anfang der Creaturn geweſen iſt. 5Aber mutwillens wollen ſie nicht wiſſen / Das der Himel vorzeiten auch war / da zu die Erde aus waſſer vnd im waſſer beſtanden / durch Gottes wort / 6Dennoch ward zu der zeit / die Welt durch b dieſelbigen mit der Sindflut verderbet. 7Alſo auch der Himel jtzund vnd die Erde / werden durch ſein Wort geſparet / das ſie zum Fewr behalten werden / am tage des gerichts vnd verdamnis der gottloſen Menſchen.
Spötter ſind vnſer Epicurer vnd Saduceer / die weder dis noch das gleuben / Leben nach jrem gefallen dahin. Oder / wie Petrus ſaget / nach jrem eigen lüſten / Thun was ſie wollen / vnd gar wol gelüſtet / Wie wir fur augen ſehen.
b
(Dieſelbigen)
Wort vnd waſſer.
8EInes aber ſey euch vnuerhalten / jr lieben / Das ein tag fur dem HERrn iſt wie tauſent jar / vnd tauſent jar wie ein tag. 9Der HERR verzeuhet nicht die Verheiſſung / wie es etliche fur einen verzug achten / Sondern er hat gedult mit vns / Vnd wil nicht / das jemand verloren werde / ſondern das ſich jederman zur Buſſe kere.
Verse 10 - 13
Die Gewissheit über das Kommen des Herrn
ES wird aber des HErrn tag komen / als ein Dieb in der nacht / In welchem die Himel zergehen werden / mit groſſem krachen / Die Element aber werden fur hitze ſchmeltzen / Vnd die Erde vnd die werck die drinnen ſind / werden verbrennen.
11SO nu das alles ſol zurgehen / wie ſolt jr denn geſchickt ſein / mit heiligem wandel vnd Gottſeligem weſen? 12das jr wartet vnd eilet zu der Zukunfft des tages des HErrn / In welchem der Himel vom fewr zurgehen vnd die Element fur hitze zerſchmeltzen werden. 13Wir warten aber eines newen Himels / vnd einer newen Erden / nach ſeiner Verheiſſung / In welchen Gerechtigkeit wonet.
Aus dem Abschnitt:
Folgerungen und Ermahnungen
Vers 14
DArumb / meine lieben / die weil jr dar auff warten ſollet / So thut vleis / das jr fur jm vnbefleckt vnd vnſtrefflich im Friede erfunden werdet.
![]()
✽
Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen
Hörbuch-Video zur Biblia 1545
 Hörbuch-Video: Mt 25,1-13
Hörbuch-Video: Mt 25,1-13
Das Video zeigt den Text des Gleichnisses von den klugen und von den törichten Jungfrauen aus der Lutherbibel von 1545, vorgelesen von Reiner Makohl.
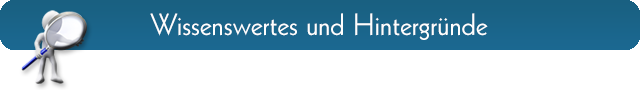
Totensonntag
Ein Gedenktag der Entschlafenen
Der Gedenktag der Entschlafenen (Totensonntag) fand bis zum Kirchenjahr 1978/1979 im evangelischen Kirchenkalender keine besondere Berücksichtigung. Er wurde gottesdienstlich nicht ausdrücklich gewürdigt, wohl aber rituell begangen.
Mit der Reform der Gottesdienstordnung von 1958/1959 führte die Lutherische Konferenz für die lutherischen Landeskirchen den Gedenktag der Entschlafenen mit einem eigenen Proprium ein. Die unierten und reformierten Landeskirchen folgten dieser Erweiterung bis zum Kirchenjahr 1978/1979 nicht.
Den letzten Sonntag im Kirchenjahr als Totensonntag zu bezeichnen, entspricht kaum reformatorischer Übung. Die Waldecker Kirchenordnung von 1556 nennt ihn »Fest des jüngsten Tages«, woraus sich sehr viel später die Idee des »Ewigkeitssonntags« entwickelte. Die Brandenburger Kirchenordnung von 1540 kennt »ein sonderlich Amt und dabei eine Predigt von den Verstorbenen«, also einen »Totensonntag«.
Martin Luther hatte den ![]() Allerseelentag abgelehnt (Predigt vom 02.11.1522), allerdings im Blick auf die Beerdigungen pietätvolles Verhalten und Gesang der Glaubens- und Auferstehungslieder gefordert. Womit zunächst Allerseelen (2. November) inhaltlich zum evangelischen Totensonntag wurde, doch nur dort, wo er auf Tradition und Akzeptanz traf.
Allerseelentag abgelehnt (Predigt vom 02.11.1522), allerdings im Blick auf die Beerdigungen pietätvolles Verhalten und Gesang der Glaubens- und Auferstehungslieder gefordert. Womit zunächst Allerseelen (2. November) inhaltlich zum evangelischen Totensonntag wurde, doch nur dort, wo er auf Tradition und Akzeptanz traf.
Das städtische Leben des 17. Jahrhunderts war durch die Bestattungen so stark geprägt, dass man sie als Reaktion darauf im 18. Jahrhundert völlig aus der Öffentlichkeit verdrängte. Daraus erwuchs die Forderung allgemeiner »Totenfeiern«.
Kirchlich angeordnet hat 1816 Friedrich Wilhelm der III. von Preußen einen »Feiertag zum Gedächtnis der Entschlafenen« (Kabinettorder vom 24.4.1816 und Verordnung vom 25.11.1816), der sich rasch auch in fast allen anderen deutschen Kirchen einbürgerte, wohl gefördert durch die Erinnerung an die Toten der Freiheitskriege.
Der letzte Sonntag im Kirchenjahr
Führte der Tag in seiner außerkirchlichen Prägung auch zu unerwünschtem Gräberkult, so ging doch die Kirche längst den Friedhofsbesuchern mit Predigten, Choralsingen und Posaunenblasen nach, um sie von hoffnungsarmer Trauer zum evangelischen Trost zu führen.
Mitte der 1950er Jahre betonte theologische Kritik am Totensonntag, dass er seinem inneren Gehalt nach ungeeignet sei, das Kirchenjahr abzuschließen.
Es erwuchs der Vorschlag, die Bezeichnung »Ewigkeitssonntag« einzuführen. Die Idee war es, zu einer vertieften Verkündigung am bisherigen Totensonntag mitzuhelfen. Die Lutherische Agende I (1955) sah vor, dass der »Gedenktag der Entschlafenen« bis auf weiteres in Verbindung mit dem letzten Sonntag des Kirchenjahres begangen werden soll. Erstmals 1957 taucht er in der Ordnung der Predigttexte unter diesem Namen mit Empfehlungen für Lesung und Predigt auf.
Interessant ist, dass heute der letzte Sonntag des Kirchenjahres als Ewigkeitssonntag und zugleich als Totensonntag begangen wird. Die Bezeichnung »Ewigkeitssonntag« hat den Namen »Totensonntag« nicht ersetzt, denn inhaltlich ergänzen sich beide Feierlichkeiten. Die evangelischen Christen gedenken damit zugleich der Bedeutung von Passion und Ostern für ihr Leben.
Die Feier des Totensonntags betont Grablegung und Trauer (Karfreitag), die Feier des Ewigkeitssonntags betont Auferstehung und Freude (Ostern). Somit hat sich der Ewigkeitssonntag zu einer freudigen, christlichen Antwort auf die Trauerrituale des Totensonntags entwickelt.
So schließt das Kirchenjahr, in dem noch einmal der Höhepunkt der christlichen Botschaft jedem evangelischen Christen in Erinnerung gerufen wird: Ja, wir sind sterblich und wir werden zu Grabe getragen werden, doch wir erwarten die Auferstehung und das ewige Leben.
Das historischen Datum
Wir haben in unseren historischen Kalendern vor 1958 den Totensonntag belassen, wenn er auch liturgisch keine Rolle gespielt haben mag. Tatsache ist wohl, dass ein Gedenktag der Entschlafenen zu jeder Zeit mindestens regional oder in gemeindlicher Praxis von evangelischen Christen begangen wurde.
Gleichzeitig haben wir den Totensonntag einheitlich dem letzten Sonntag des Kirchenjahres zugeordnet, wenn er auch zu bestimmten Zeiten oder regional an anderen Tagen begangen worden sein mag. Hier fehlen uns derzeit genaue Angaben und Quellen, um eine bessere Zuordnung des Totensonntags zu einem historischen Datum einzurichten.
Im gewählten Jahr ist der ![]() 24. Sonntag nach Trinitatis der letzte Sonntag des Kirchenjahres.
24. Sonntag nach Trinitatis der letzte Sonntag des Kirchenjahres.
»Frewet euch mit den Frölichen /
vnd weinet mit den Weinenden.
Habt mit allen Menſchen Friede.«
Zum Gebrauch
Der Rückblick auf die Perikopenordnungen vergangener Jahrhunderte zeigt auf, wie sich die Verwendung der biblischen Texte in evangelischen Gottesdiensten im Laufe der Zeit veränderte.
Wir beschränken uns in den weit zurückliegenden Jahren auf Perikopenordnungen, die überwiegend in Gebrauch waren.
Durch die neue Ordnung für die Verwendung von Sprüchen, Psalmen, Bibeltexten und Liedern in Gottesdiensten sind die alten Ordnungen zwar liturgisch überholt, aber inhaltlich deswegen keineswegs falsch.
Wir möchten Sie daher ermuntern, die in alter Zeit verwendeten Perikopen zu betrachten. Nur so können Sie ergründen, ob das, worauf sich Pfarrer vor Hunderten von Jahren in Gottesdienst und Predigt stützten, auch noch heute aktuell ist. Aktuell für Sie ganz persönlich.

™Hinweise zur Stilkunst.de-Ausgabe
Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Bibeltextes
Der Text aus der Lutherbibel ist auf unseren Seiten in Anlehnung an das Druckbild des Originals von 1545 wiedergegeben.
Den Seitenaufbau, die verwendeten Schriften, die Schreibregeln der Frakturschrift und Luthers Intentionen, mit der Typografie Lesehilfen bereitzustellen, erläutert dem interessierten Leser unser Artikel »Satz und Typografie der Lutherbibel von 1545«.
/Preview-Mt_25(1-13).png)