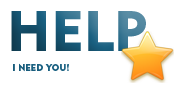Die Namen der Sonntage
Septuagesimä, Sexagesimä, Quinquagesimä und Quadragesimä

Begriffserklärungen
Die Bedeutung der Sonntagsnamen
Septuagesimä, Sexagesimä, Quinquagesimä und Quadragesimä
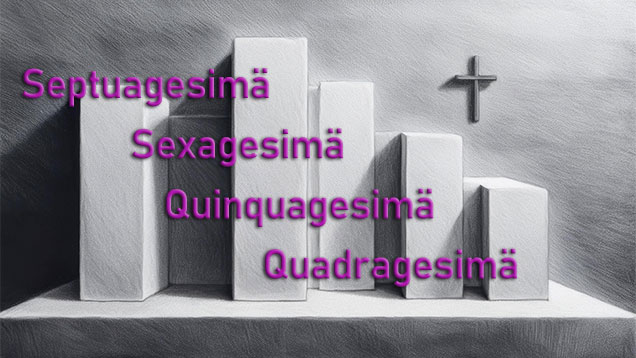
Grafik: Die Namen der Sonntage Septuagesimä, Sexagesimä, Quinquagesimä und Quadragesimä.
Bis heute sind in der Vorpassionszeit und in der Passionszeit die alten lateinischen Namen der Sonntage gebräuchlich. Das was bedeuten Sie?
©by Reiner Makohl | lizenziert für www.stilkunst.de
Einleitung
In den Kalendern tauchen in der Zeit nach Epiphanias die lateinischen Sonntagsnamen Septuagesimä, Sexagesimä, Quinquagesimä und Quadragesimä auf. Was bedeuten diese Namen?
Seit dem Mittelalter gibt es dazu recht unterschiedliche Erklärungen, von denen manche doch sehr weit vom Ursprung der Namensgebung entfernt scheinen. Auch in den modernen Interpretationen tauchen Erklärungen auf, die durchaus selbst ihre Unstimmigkeiten erkennen, aber bemüht sind, sie mit religiösen Begründungen zu glätten. So werden beispielsweise rechnerische Abweichungen gerne mit absichtlichen Rundungen erklärt, was sicher kaum haltbar ist.
Viele Interpretationen der Namen befriedigen nicht. Es wird oft übersehen, dass es letztendlich um Namen in einem Kalender geht, also dort, wo Zahlen ins Spiel kommen, um Kalenderarithmetik im Zusammenhang mit der chronologischen Abbildung der biblischen Ereignisse vom Fasten, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu im Kalenderjahr.
Für uns ist es heute schwierig, lateinische Namen nachzuvollziehen, wo wir doch im kirchlichen Umfeld fast keine lateinischen Ausdrücke, Formeln, Bekenntnisse oder Glaubenssätze mehr nutzen. Ein Sonntagsname wie Septuagesimä dürfte heute auch praktizierenden Christen kaum etwas sagen. Die Namen scheinen auf formelle Bezeichnungen reduziert, ähnlich den Zahlen, die dazu dienen, Tage im Monat zu kennzeichnen. Es sind oft nur noch »Labels«, Aufkleber ohne inhaltliche Bedeutung.
Heute heißen diese Sonntage daher recht schlicht »3. Sonntag vor der Passionszeit«, »2. Sonntag vor der Passionszeit«, »Sonntag vor der Passionszeit« und »1. Sonntag der Passionszeit«, wenn auch die alten Bezeichnungen nach wie vor gelten, hier und da in Gebrauch sind und in Leseordnungen und kirchlichen Kalendern abgedruckt werden.
A. Der Ursprung der Namensgebung
Die Namensgebung wurzelt in einer gewissen theologisch-religiösen Numerologie: Zahlen bekommen Bedeutung, insbesondere im rituellen und heilsgeschichtlichen Sinn. Doch welchen Sinn haben die Zahlen 70, 60, 50 und 40, die sich in den lateinischen Namen dieser Sonntage verbergen?
Diese Zahlen beschreiben ganz schlicht Zeitspannen, also 70 Tage, 60 Tage, 50 Tage und 40 Tage, die jeweils ab dem bestimmten Sonntag zählen.
Die Sonntage stellen für die jeweilige liturgische Zeitspanne den Beginn, eine öffnende Klammer dar, die Endpunkte schließen die Klammer und so die Zeitspanne ab.
Um den jeweils letzten Tag zu ermitteln, der die Zeitspanne im Kalender abschließt, genügt es, ab dem jeweiligen Sonntag die genannte Zahl an Tagen abzuzählen. [![]() 1] Das Ergebnis ist jeweils ein wichtiger liturgischer und zugleich heilsgeschichtlich bedeutsamer Tag im Kalender.
1] Das Ergebnis ist jeweils ein wichtiger liturgischer und zugleich heilsgeschichtlich bedeutsamer Tag im Kalender.
B. Die Zeit von Gründonnerstag bis zum Ende der Osterwoche
Die Zeit zwischen den Sonntagen Septuagesimä und Quadragesimä spiegelt mit ihren Sonntagsnamen die gesamte Zeitspanne zwischen ![]() Gründonnerstag und
Gründonnerstag und ![]() Quasimodogeniti und richtet so den Blick auf das
Quasimodogeniti und richtet so den Blick auf das ![]() Triduum Sacrum, das Triduum Paschale und die Osteroktav.
Triduum Sacrum, das Triduum Paschale und die Osteroktav.
C. Die Sonntage und ihre Namen
1. Septuagesimä
Der Sonntag Septuagesimä (lat.: septuagesima: Siebzigster) ist - sofern im Kalender vorhanden! [![]() 2] - der dritte Sonntag vor der Passionszeit.
2] - der dritte Sonntag vor der Passionszeit.
Der Name bedeutet: der siebzigste [Tag]. Der Sonntag liegt 63 Tage vor Ostern. Er zeigt nicht auf Ostersonntag, sondern auf das Ende der Osterwoche, auf den Tag vor dem Sonntag ![]() Quasimodogeniti, den siebzigsten Tag ab Septuagesimä.
Quasimodogeniti, den siebzigsten Tag ab Septuagesimä.
Die mittelalterliche Bezeichnung »Dominica septuagesime« ist ein fester Name für diesen Sonntag. Übersetzt würde er etwa lauten: »Sonntag, welcher der 70. [Tag vor Quasimodogeniti] ist«.
Der Name bezeichnet somit die siebzigtägige Zeit zwischen dem Samstag vor Septuagesimä, an dem letztmals vor Ostern das dreifache Halleluja im Gottesdienst gesungen werden durfte, und dem Sonntag Quasimodogeniti, an dem es erstmals nach Ostern wieder sein Platz im Gottesdienst hatte.
1.1. Die Bedeutung als Fastenzeit
Heute kennen wir als vorösterliche Fastenzeit die Zeit von Aschermittwoch bis Karsamstag. Das war in der Kirchengeschichte keineswegs immer so.
In der alten Kirche gab es eine Zeit [![]() 3], in der die Fastenzeit mit dem Sonntag Septuagesimä begann. Dies begründete sich so:
3], in der die Fastenzeit mit dem Sonntag Septuagesimä begann. Dies begründete sich so:
Wegen der Verehrung des Himmelfahrtstages, immer ein Donnerstag, wurde der fünfte Wochentag, also der Donnerstag, feierlich begangen. An diesem Tag wurde wie an Sonntagen (Verehrung des Auferstehungstages) in Fastenzeiten nicht gefastet. [![]() 4]
4]
In dieser Fastenzeit waren also Sonntage und Donnerstage nicht zu zählen. Eine Fastenwoche umfasste fünf Fastentage.
Anders als in späteren Zeiten endete die Fastenzeit am Samstag vor Palmsonntag, nicht am Karsamstag. Mit dem Palmsonntag begann die heilige Woche, die dann als gesonderter Abschnitt mit weiteren Fastentagen als Trauerfasten und Osterfasten gerechnet wurde.
Werden nun rückwärts nach dieser Regel ab dem Samstag vor Palmsonntag, dem letzten Fastentag, 40 Tage gezählt, ohne Sonntage und ohne Donnerstage zu zählen (das sind genau acht Wochen), beginnt das Fasten am Montag nach Septuagesimä. Die 40-tägige Fastenzeit wird eingeschlossen durch die Sonntage Septuagesimä und Palmarum.
Jacobus de Voragine schreibt in seiner Legenda Aurea nach der Erklärung, dass an Donnerstagen nicht gefastet wurde: »Zum Ausgleich fügten die heiligen Väter eine Woche zur Fastenzeit hinzu und nannten sie Septuagesima.« [![]() 4].
4].
Doch diese Erklärung ist nicht hinreichend. Der Name Septuagesimä ist sicher nicht aus der 40-tägigen Fastenzeit abzuleiten.
Anmerkungen:
Dass es in der Woche nach Septuagesimä irgendwann im Laufe der Geschichte Fastentage gab, ist sicher richtig. So waren der Mittwoch und der Freitag sowieso verpflichtende Fastentage in fast allen Wochen des Jahres, auch in jener Woche.
Und ![]() Erwin Mühlhaupt (Bd. 2, S.155) weist darauf hin, dass sich Luthers Bezeichnungen »Goldfasten oder Notfasten« bzw. »Goldfasten oder Fronfasten« (Luthers Wochenpredigten 1530/1532, zu Mt 6,16-18,
Erwin Mühlhaupt (Bd. 2, S.155) weist darauf hin, dass sich Luthers Bezeichnungen »Goldfasten oder Notfasten« bzw. »Goldfasten oder Fronfasten« (Luthers Wochenpredigten 1530/1532, zu Mt 6,16-18, ![]() WA 32,428-436) auf die Quatembertage des Jahres beziehen, wobei er das erste Quatemberfasten am Mittwoch, Freitag und Samstag nach Septuagesimä im Kalender verortet. Dies scheint nicht haltbar zu sein.
WA 32,428-436) auf die Quatembertage des Jahres beziehen, wobei er das erste Quatemberfasten am Mittwoch, Freitag und Samstag nach Septuagesimä im Kalender verortet. Dies scheint nicht haltbar zu sein.
Das Fronfasten meint das »Quatemberfasten« (verkürzt aus lat.: Quattuor temporum, vier [Jahres-] Zeiten). Es wurde Mittwochs, Freitags und Samstags zum Beginn der vier Jahreszeiten begangen.
Siehe ![]() Legenda Aurea Seite 503ff., Artikel Quatemberfasten. »Das erste derartige Fasten findet im März statt, d. h. in der ersten Fastenwoche,...«. (S. 503 10)
Legenda Aurea Seite 503ff., Artikel Quatemberfasten. »Das erste derartige Fasten findet im März statt, d. h. in der ersten Fastenwoche,...«. (S. 503 10)
In den Anmerkungen dazu ist zu lesen (S. 502), dass die Synode von 1078 unter Papst Gregor VII. (1073–1085) die Termine für das Quatemberfasten festgelegt hatte. Dann kann seit jener Zeit das Quatemberfasten im Frühling nicht in der Woche nach Septuagesimä gelegen haben. Septuagesimä liegt zwischen dem 18. Januar und dem 21. Februar eines Jahres, jedoch nie im März.
Das macht eine Erklärung der Septuagesimä-Woche als Fastenwoche noch schwieriger. Luthers Gold- oder Fronfasten (Quatemberfasten) wäre damals Teil des Quadragesima major, der großen, vierzigtägigen Fastenzeit vor Ostern gewesen.
1.2. Die Bedeutung in der mittelalterlichen Taufpraxis
Die Zeitspanne Septuagesima, vom Sonntag Septuagesimä bis zum Samstag vor dem »Weißen Sonntag« (lat.: Dominica Alba, das ist der Sonntag Quasimodogeniti, der Sonntag nach Ostern), war eine Zeit der Vorbereitung für die christliche Taufe und die Einführung der Täuflinge (Katechumenen) in die Gemeinde.
In der frühen Kirche wurden Taufen fast ausschließlich in der Osternacht vollzogen. Dabei ging es um die Taufe erwachsener Menschen. Die neugetauften Christen trugen während der gesamten Osterwoche (das ist die Woche nach Ostern) weiße Gewänder, um ihre neue Reinheit und Zugehörigkeit zu Christus zu symbolisieren.
Der Samstag vor dem »Weißen Sonntag« war der letzte Tag dieser Vorbereitungszeit und der Einführung der Neugetauften in die christliche Gemeinde.
Am »Weißen Sonntag« legten die Neugetauften ihre weißen Gewänder ab und waren von diesem Tag an Teil der christlichen Gemeinschaft.
Heute lässt sich die Gegenwart des altkirchlichen Namens Septuagesimä für diesen Sonntag im Kalender nicht mehr mit der Taufpraxis begründen. Die kirchliche Praxis der Taufe und der Vorbereitung für die Einführung in die Christengemeinde hat sich mit der nun üblichen Kindstaufe komplett geändert.
1.3. Die Bedeutung als Versinnbildlichung
Bereits im Mittelalter kam die numerologisch begründete Erklärung auf, die Zeitspanne Septuagesima stelle die 70 Jahre dar, in denen die Kinder Israels in der Babylonischen Gefangenschaft waren. [![]() 5]
5]
In dieser Zeit wurde auf Lobgesänge verzichtet (gemäß ![]() Psalm 137,4: »Wie sollen wir den Lobgesang des Herrn singen im fremden Land?«).
Psalm 137,4: »Wie sollen wir den Lobgesang des Herrn singen im fremden Land?«).
Bis Karsamstag wurde daher in den Messen kein »Halleluja« mehr gesungen. [![]() 6]
6]
Am Karsamstag durfte ein einfaches Halleluja gesungen werden, was die Freude über die im 60. Jahr vom babylonischen König erteilte Erlaubnis zur Rückkehr der Deportierten nach Jerusalem versinnbildlichen sollte. [![]() 7]
7]
Am Samstag vor Quasimodogeniti durfte ein doppeltes Halleluja gesungen werden, was die Freude der Rückkehrenden auf ihrem Weg nach Jerusalem versinnbildlichen sollte. [![]() 8]
8]
Doch erst am Sonntag Quasimodogeniti erklang wieder das dreifache »Halleluja, Halleluja, Halleluja« in den Kirchen. [![]() 9] Die 70-tägige Zeitspanne, welche die 70-jährige Verirrung in der Verbannung symbolisiert, war vorüber.
9] Die 70-tägige Zeitspanne, welche die 70-jährige Verirrung in der Verbannung symbolisiert, war vorüber.
Bis heute wird der Zeitspanne Septuagesima diese Bedeutung zugemessen, um den Sonntagsnamen zu erklären. Obwohl die kirchliche Praxis das kaum stützt: Das dreifache Halleluja wird längst in der Osterwoche vor Quasimodogeniti gesungen. [![]() 10]
10]
Die Osterwoche thematisiert die Rückkehr der Juden aus der Babylonischen Gefangenschaft nicht.
2. Sexagesimä
Der Sonntag Sexagesimä (lat. sexagesima: sechzig) ist der zweite Sonntag vor der Passionszeit.
Der Name bedeutet: [die Zeit] der sechzig [Tage]. Er liegt 56 Tage vor Ostern. Er zeigt nicht auf Ostersonntag, sondern auf die Mitte der Osterwoche, auf den Mittwoch nach Ostersonntag, den sechzigsten Tag ab Sexagesimä.
Der Name nennt die Zahl der Tage ab diesem Sonntag bis zum Ende des (mittelalterlichen) ![]() Triduum Paschale bzw. bis zum letzten der vier heiligen Tage, Ostersonntag bis Mittwoch der Osterwoche, die im Mittelalter eine besondere Verehrung erfuhren. [
Triduum Paschale bzw. bis zum letzten der vier heiligen Tage, Ostersonntag bis Mittwoch der Osterwoche, die im Mittelalter eine besondere Verehrung erfuhren. [![]() 11]
11]
Die mittelalterliche Bezeichnung »Dominica sexagesime« ist ein fester Name für diesen Sonntag. Übersetzt würde er etwa lauten: »Sonntag, welcher der 60. [Tag vor dem Ende heiligen vier Tage] ist«.
Schon im Mittelalter tat man sich schwer, den Namen des Sonntags Sexagesimä zu erklären. Erklärungen verweisen auf Fastenzeiten, auf biblische Zahlensymbolik und auf eschatologisches Heilsgeschehen.
2.1. Die Bedeutung als Fastenwoche
Einst sollen Papst Militades (Melchiades; Papst von 311 bis 314) und vom heiligen Silvester (Papst von 314 bis 335) verfügt haben, dass an Samstagen zweimal zu essen sei, um die Gefahr von Mangelernährung durch das Freitagsfasten zu vermeiden. [![]() 12]
12]
Da diese Regel auch in der großen, vorösterlichen Fastenzeit (der Quadragesima major) galt, wurde an Sonntagen und folglich auch an Samstagen nicht gefastet.
Nun entfielen dadurch sechs Fastentage in den Fastenwochen. Die Päpste sollen daher zugleich verfügt haben, dass die Fastenzeit eine Woche früher beginne. Gefastet wurde nun vom Sonntag Sexagesimä bis zum Karsamstag, faktisch vom Montag nach Sexagesima bis Karfreitag, weil an Sonntagen und Samstagen nach päpstlicher Verfügung nicht gefastet wurde. So ergeben sich genau 40 Fastentage im Kalender.
Doch diese Darstellung genügt nicht, um den Namen Sexagesimä für diesen Sonntag zu erklären. Es würde nur erklären, dass der 40-tägigen Fastenzeit (die Quadragesima) nun am Tag nach Sexagesimä begann.
2.2. Die Bedeutung aus Zahlensymbolik heraus
Jacobus de Voragine schreibt in seiner Legenda Aurea: Sexagesima heißt sechs mal zehn: »Unter 6 sollen wir die sechs Werke der Barmherzigkeit, unter 10 die zehn Gebote verstehen.« [![]() 13]
13]
Die sechs Werke der Barmherzigkeit sind in Mt 25,31-46 genannt: 1. Hunger stillen, 2. Durst stillen, 3. Fremde beherbergen, 4. Nackte bekleiden, 5. Kranke besuchen und 6. Gefangene besuchen.
Jedes dieser sechs Werke begründet sich in den zehn Geboten und wird aus ihnen heraus vollbracht. 6 x 10 = 60.
Theologisch wurde jene Zeit als eine Zeit der Verwitwung der Kirche gesehen, denn der Bräutigam war entrückt (Himmelfahrt). Zurück blieben zum Trost zwei Flügel, die kirchliches Handeln tragen können: die sechs Werke der Barmherzigkeit und die zehn Gebote.
Auch diese Erläuterungen erklären den Namen Sexagesimä nicht hinreichend. Weder am Sonntag Sexagesimä noch in folgenden Wochen geht es um die Verwitwung der Kirche durch die Entrückung des Bräutigams.
Den einzigen schwachen Hinweis bietet der Introitus zu diesem Tag: »Exsurge, quare obdormis, Domine« (»Wach auf! Warum schläfst du, Herr?«, ![]() Psalm 44,24).
Psalm 44,24).
Doch dieser Introitus steht in Folge des Introitus zum vorhergehenden Sonntag Septuagesimä: »Circumdederunt me« (»Es umringten mich«, ![]() Psalm 18,5). Die dort bedrängte Kirche ruft nun den Herrn, aufzustehen und nicht zu schlafen, damit er sie errette. Dies hat nichts mit Entrückung, Himmelfahrt und Verwitwung der Kirche zu tun.
Psalm 18,5). Die dort bedrängte Kirche ruft nun den Herrn, aufzustehen und nicht zu schlafen, damit er sie errette. Dies hat nichts mit Entrückung, Himmelfahrt und Verwitwung der Kirche zu tun.
2.3. Die Bedeutung aus dem Geheimnis der Erlösung
Jacobus de Voragine schreibt in seiner Legenda Aurea: »Unter 10 ist der Mensch zu verstehen. [...] Unter der Zahl 6 versteht man die sechs Geheimnisse, durch die der Mensch, das zehnte Wesen, erlöst wurde: Fleischwerdung, Geburt, Passion, Höllenfahrt, Auferstehung, Himmelfahrt.« [![]() 14]
14]
Weiter schreibt er: »So dehnt sich Sexagesima bis zum 4. Wochentag (Mittwoch) nach Ostern aus, an dem man Venite benedict patris mei („Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters,“ ![]() Mt 25,34) singt, denn die sich in den Werken der Barmherzigkeit üben, werden hören „Kommt, ihr Gesegneten“, wie Christus selbst bezeugt, denn dann wird man der Braut die Tür öffnen, und sie wird die Umarmung des Bräutigams genießen.«
Mt 25,34) singt, denn die sich in den Werken der Barmherzigkeit üben, werden hören „Kommt, ihr Gesegneten“, wie Christus selbst bezeugt, denn dann wird man der Braut die Tür öffnen, und sie wird die Umarmung des Bräutigams genießen.«
Aber auch diese Erläuterungen erklären den Namen Sexagesimä inhaltlich nicht hinreichend.
Übrig bleibt eindeutig nur die Bedeutung von Sexagesima als 60-tägige Zeitspanne, wie es auch von Jacobus de Voragine mehrfach angeführt wurde. Der Sinn dahinter bleibt ebenso vieldeutig wie rätselhaft.
3. Quinquagesimä
Der Sonntag Quinquagesimä (lat. quinquagesima: fünfzig) ist der letzte Sonntag vor der Passionszeit. Heute wird er fast nur noch unter den Namen »Sonntag vor der Passionszeit« oder »Estomihi« geführt. Doch seit dem Mittelalter ist auch die lateinische Bezeichnung Quinquagesimä gebräuchlich.
Der Name bedeutet: [die Zeit] der fünfzig [Tage]. Er liegt 49 Tage vor Ostern und zeigt tatsächlich auf Ostersonntag, dem fünfzigsten Tag ab Quinquagesimä.
Der Name nennt die Zahl der Tage ab diesem Sonntag bis zum Ende des ![]() Triduum Sacrum und dem Beginn des (mittelalterlichen) Triduum Paschale.
Triduum Sacrum und dem Beginn des (mittelalterlichen) Triduum Paschale.
Die mittelalterliche Bezeichnung »Dominica quinquagesime« ist ein fester Name für diesen Sonntag. Übersetzt würde er etwa lauten: »Sonntag, welcher der 50. [Tag vor Ostersonntag] ist«.
3.1. Die Bedeutung als Fastenwoche
Auch Quinquagesima wurde mit einer zusätzlichen Fastenwoche im Kalender begründet.
So war klar, dass die Fastenzeit (Quadragesima) ab dem Sonntag Quadragesimä nur 36 Tage umfassen konnte, weshalb vier Tage vor dem Sonntag Quadragesimä zur Fastenzeit gerechnet wurden. Die Fastenzeit begann am Aschermittwoch. [![]() 15]
15]
Anders als das Volk fasteten die Kleriker auch an den beiden Tagen vor Aschermittwoch. So wurde schließlich eine ganze Woche daraus, die man Quinquagesima nannte. Das sei so bereits von »Papst« Telesphorus (Bischof von Rom um 125 bis um 136) angeordnet worden.
Der Name Quinquagesima lässt sich aus diesen 6 Fastentagen vor dem Sonntag Quadragesimä nicht erklären. Zwar sind es ab dem Sonntag Quinquagesimä 50 Kalendertage bis Ostern, doch sind es inklusive der zusätzlichen zwei Fastentage für die Kleriker nur 42 Fastentage. Auch ohne die Verlängerung der Fastenzeit wären es 50, also Quinquagesima, Kalendertage.
Es ist keine Verbindung zwischen dem Namen des Sonntags und der Fastenzeit erkennbar.
3.2. Die Bedeutung des 50. Jahrs, des Erlassjahrs
Jacobus de Voragine schreibt in seiner Legenda Aurea: »Quinquagesima bedeutet Zeit der Vergebung, d. h. Zeit der Buße, nach der alles vergeben wird, denn das 50. Jahr war das Jubeljahr, das Jahr der Vergebung, weil da Schulden erlassen, die Sklaven befreit wurden und alle in ihre Besitzungen zurückkehrten.« [![]() 16]
16]
Dies ist ein sehr wichtiges Thema, dem auch heute theologisch Bedeutung zufallen sollte. Doch es ist sehr sicher nicht die Ursache für den Namen des Sonntags Quinquagesimä.
3.3. Die Versinnbildlichung mittels Zahlensymbolik
Nach Jacobus de Voragine ist die Zahl 50 mehrfach von Bedeutung: »Denn im 50. Jahr wurden die Sklaven frei, am 50. Tag nach dem Tag des Opferlamms wurde das Gesetz erlassen, am 50. Tag nach Ostern wurde der heilige Geist verliehen, darum versinnbildlicht die Zahl 50 die Seligkeit, in der sich Erlangung der Freiheit, Erkenntnis der Wahrheit und Vollendung der Liebe einstellen werden.« [![]() 17]
17]
Nach dem sorgenvollen Schrei »Circumdederunt me« (»Es umringten mich«, ![]() Psalm 18,5) vom Sonntag Septuagesimä, und dem Hilferuf »Exsurge, quare obdormis, Domine« (»Wach auf! Warum schläfst du, Herr?«,
Psalm 18,5) vom Sonntag Septuagesimä, und dem Hilferuf »Exsurge, quare obdormis, Domine« (»Wach auf! Warum schläfst du, Herr?«, ![]() Psalm 44,24) vom Sonntag Sexagesimä folgt nun als Introitus zu diesem Sonntag konsequenterweise die Bitte »Esto mihi in deum protectorem« (»Sei mir ein schützender Gott«,
Psalm 44,24) vom Sonntag Sexagesimä folgt nun als Introitus zu diesem Sonntag konsequenterweise die Bitte »Esto mihi in deum protectorem« (»Sei mir ein schützender Gott«, ![]() Psalm 31,3).
Psalm 31,3).
Die wohl bedeutsamste Erklärung liefert Jacobus de Voragine am Ende seines Kapitels über Quinquagesima: »Quinquagesima endet [...] an Ostern, weil die Buße uns zu einem neuen Leben auferstehen läßt.« [![]() 18]
18]
4. Quadragesimä
Der Sonntag Quadragesimä (lat. quadragesima: vierzig) gehört bereits zur Passionszeit und wird heute fast nur noch unter den Namen »Erster Sonntag der Passionszeit« oder »Invokavit« geführt. Doch seit dem Mittelalter ist auch die Bezeichnung Quadragesimä gebräuchlich.
Der Name bedeutet: [die Zeit] der vierzig [Tage]. Er nennt damit die Zahl der Tage ab diesem Sonntag bis Gründonnerstag, bis zum Beginn des (mittelalterlichen) Triduum Sacrum und der Passion Christi.
Die mittelalterliche Bezeichnung »Dominica quadragesime« ist ein fester Name für diesen Sonntag. Übersetzt würde er etwa lauten: »Sonntag, welcher der 40. [Tag vor dem Beginn der Passion Christi] ist«.
Der doppeldeutige Name
Obwohl der Sonntag Quadragesimä (Invokavit) der erste Sonntag in der Fastenzeit ist, hat der Name primär nichts mit der vierzigtägigen Fastenzeit zu tun. [![]() 19]
19]
Vom Namen des Sonntags zu unterscheiden ist die namensgleiche »Quadragesima«, die 40 Tage umfassende Fastenzeit.
Heute wird jedoch der Name fast ausschließlich mit der Fastenzeit begründet, obwohl alle Erklärungen immer erläutern müssen, warum die 40-tägige Fastenzeit gar nicht an diesem Sonntag beginnt.
Teilweise führt das zu paradoxen Erklärungen. So schreibt Jacobus de Voragine in der Legenda Aurea zunächst: »Quadragesima, die Fastenzeit, beginnt am Sonntag, an dem man Invocavit me (Er rief mich an [...]) singt«, [![]() 20] was eindeutig falsch ist.
20] was eindeutig falsch ist.
Jacobus de Voragine korrigiert das auch kurz darauf, in dem er ausführt, dass Quadragesima 42 Tage umfasse, und ohne Sonntage nur 36 Fastentage blieben, weshalb die vier Tage vor dem Sonntag, an dem man Invocavit me singt, zur Fastenzeit hinzuzurechnen seien. Man beachte, wie er bemüht ist, zu vermeiden das Wort Quadragesima in der Bedeutung 40-tägige Fastenzeit als Sonntagsnamen zu verwenden.
Tatsächlich wurde der Sonntag auch als »Dominica prima Quadragesime« bezeichnet (»erster Sonntag in der Fastenzeit«), was ihn zwar als Sonntag der Fastenzeit auszeichnete, aber kaum sein eigentlicher Name war. Die folgenden Sonntage (Reminiszere, Okuli, etc.) wurden entsprechend »Dominica secunda Quadragesime« (zweiter Sonntag der Fastenzeit), »Dominica tertia Quadragesime« usw. genannt.
Was folgt nun daraus?
Einmal haben wir mit Quadragesimä (Dominica Quadragesimä) den Namen eines Sonntags, der eine 40-tägige Zeitspanne einleitet, die definitiv an diesem Sonntag beginnt, entsprechend den Zeitspannen Quinquagesima, Sexagesima und Septuagesima. Die Zeitspanne endet am Gründonnerstag.
Dann haben wir mit Quadragesimä einen verkürzten Namen, der in der vollen Schreibweise Dominica prima Quadragesimä heißen müsste, erster Sonntag in der 40-tägigen Fastenzeit. Die Fastenzeit beginnt am Aschermittwoch (»Quadragesima intrans«, »Start der Fastenzeit«) und endet am Karsamstag (»Sabbatum paschale«, Samstag vor Ostern), wobei bei der Zählung der Tage die Sonntage nicht mitgezählt werden.
D. Zusammenfassung der Ergebnisse
1. Die Gegenwart fehlerhafter Erklärungen
Die Sonntagsnamen Septuagesimä, Sexagesimä, Quinquagesimä und Quadragesimä sind nur schwerlich erklärbar.
Viele alte Erklärungen, wie sie sich in der Legenda Aurea finden, wirken aufgesetzt und nachträglich konstruiert, weil die Fragen nach dem Sinn der Zahlenwerte sich immer stellten und nach liturgischen Antworten drängten. Sie verdecken allerdings nicht zuletzt durch die Autorität ihrer Autoren letztendlich den wahren Sinn, der sich hinter den Namen verbirgt.
Alle Erklärungen, die von »Rundungen« oder »symbolischen Zahlenwerten« ausgehen, sind haltlos, weil simples Abzählen von Tagen im Kalender sehr schnell nachweist, dass es für bestimmte Erklärungsansätze mit den runden Zahlen 70, 60, 50 oder 40 gar nicht klappt. [![]() 21]
21]
Es gibt außer Mutmaßungen weder logische noch vernünftige Gründe, solche Abweichungen in konzeptionellen Berechnungen als Rundungen oder numerologische Symbolik zu deuten. Dies unterstellt zudem den alten Vätern der Kirchenordnungen, dass sie es mit Kalenderarithmetik nicht so genau nahmen. Doch die Gestalt der kirchlichen Kalender belegt etwas anderes.
Die Erklärung im evangelischen Perikopenbuch
Für uns evangelische Christen ist das Perikopenbuch eine wichtige Quelle, die das evangelische Kirchenjahr erklärt und füllt. Doch auch die Ausführungen im aktuellen Perikopenbuch 2018 sind sicher nicht haltbar. Dort heißt es:
»Im 6. Jahrhundert wurde der vierzigtägigen Fastenzeit (lat. quadragesima) eine ›Vorfastenzeit‹ vorangestellt. Sie begann mit dem heutigen Sonntag, der etwa 70 Tage vor Ostern liegt, daher stammt der lateinische Name ›Septuagesimä‹ (der Siebzigste). Der nachfolgende Sonntag heißt dementsprechend ›Sexagesimä‹ (der Sechzigste).«
(![]() Perikopenbuch 2018, Sonntag Septuagesimä, Erläuterungsblatt zwischen den Seiten 134 und 135 im Abschnitt der Erklärungen zum »Kontext«).
Perikopenbuch 2018, Sonntag Septuagesimä, Erläuterungsblatt zwischen den Seiten 134 und 135 im Abschnitt der Erklärungen zum »Kontext«).
Die Formulierung »der etwa 70 Tage vor Ostern liegt« genügt keineswegs, um den Namen zu erklären und bezeugt eher Unklarheit statt Klarheit. Die weitere Formulierung, »Der nachfolgende Sonntag heißt dementsprechend ...«, kann ebenfalls weder zur Erklärung des Namens Septuagesimä noch des Namens Sexagesimä beitragen.
2. Die Zeiträume und das Osterfest
Etliche moderne Erklärungen gehen fälschlierweise davon aus, dass alle genannten Zeiträume an Ostersonntag enden. Doch dies trifft nur für den Zeitraum Quinquagesima zu, der am Sonntag Quinquagesimä beginnt.
Der klare Widerspruch der tatsächlichen Abstände der Sonntage Septuagesimä und Sexagesimä zu der mit dem Namen genannten Zahl 70 bzw. 60 wird dann mit absichtlicher Rundung oder übergeordneter Zahlensymbolik begründet.
Schon die im Mittelalter entstandene Legenda Aurea erklärt unmissverständlich, dass ...
- ... Septuagesima den Zeitraum vom Sonntag Septuagesimä bis zum Samstag vor Quasimodogeniti bezeichnet,
- ... Sexagesima den Zeitraum vom Sonntag Sexagesimä bis zum Mittwoch nach Ostern umfasst,
- ... Quinquagesima den Zeitraum vom Sonntag Quinquagesimä bis zum Ostersonntag meint.
Quadragesimä nimmt durch den doppeldeutigen Namen eine Sonderrolle ein. Quadragesimä als Sonntagsname gehört wie folgt in diese Reihe der Namensgebungen:
- Quadragesima meint den Zeitraum vom Sonntag Quadragesimä bis Gründonnerstag.
Mit dem Sonntagsnamen Quadragesimä ist nicht die 40-tägige Fastenzeit gemeint.
3. Die 40-tägige Fastenzeit
Vom Namen des Sonntags Qudragesimä zu unterscheiden ist die namensgleiche »Quadragesima major«, die »große vierzigtägige« (Fastenzeit). Das lateinische Wort »Quadragesima« meint »der Vierzigste (Tag)«, aber auch, »die Vierzig« und ist in dieser Bedeutung im religiösen Gebrauch die übliche Verkürzung aus dem längeren Ausdruck »die vierzig Tage des Fastens (vor Ostern)«.
Ist die Fastenzeit gemeint, müssen Tagesbezeichnungen gesondert ausgezeichnet werden. So wird der Sonntag in Urkunden auch dominica prima quadragesime oder dominica initii quadragesime oder »dominica I. quadragesime« genannt, was jeweils erster Sonntag Fastenzeit bedeutet.
Diese Fastenzeit begann nie am Sonntag Quadragesimä, sondern unter der Regel, dass an Sonntagen nicht gefastet werden darf und Karsamstag der letzte Fastentag ist, am Aschermittwoch.
Nach altkirchlichen Regeln, wo zusätzlich an Donnerstagen nicht gefastet werden durfte und der Samstag vor Palmarum der letzte Fastentag war, begann die Fastenzeit sogar an Septuagesimä. Sie war dennoch die Quadragesima major, weil sie immer 4o Fastentage umfasste, egal, wann sie begann.
Auch die Fastenzeit der alten Kirche vor Weihnachten (40 Kalendertage ab dem 14. November inkl. fastenfreier Tage) hieß Quadragesima (Quadragesima Martini [![]() 22]).
22]).
In dieser Zeitspanne steht Quadragesima nicht für die Anzahl der Fastentage, sondern für die Summe der Kalendertage. Der Begriff Quadragesima nimmt unterschiedliche Bedeutungen an.
4. Mögliche Bedeutungen im Kirchenjahr
Faktisch sehen wir vier ineinandergeschachtelte Klammern im Kirchenjahr. Nach der Epiphaniaszeit folgt die für die Christen bedeutsamste Zeit, die von Buße (Vorpassionszeit, Passionszeit), eschatologischer Erwartung (Palmsonntag), bußfertiger Trauer (Karwoche), Leiden (Passion; Karfreitag), stiller Trauer (Grabesruhe; Karsamstag), Freude (Ostern) und christlichem Aufbruch (nachösterliche Freudenzeit) geprägt ist.
Die vier Sonntage richten unseren Blick in die Zukunft:
- Septuagesimä führt uns zunächst in die stille, überwiegend freudlose Zeit der Buße, verweist uns aber zugleich auf das glückliche Ende. Alle Buße, Trauer und alles Leid mündet in der Freude über die Auferstehung und feiert in der nachösterlichen Freudenzeit.
Diese 70 Tage sind die große Klammer, der vollständige Plot über die Rüstzeit, die Zeiten der Buße, der Passion Christi, der Trauer, der Auferstehung, der Begegnungen mit dem Auferstandenen und der Freude darüber. - Sexagesimä ist als Wegmarke ein Hinweis, wie schnell wir uns dem Leiden, dem Sterben und der Auferstehung nähern. Doch am Ende steht die Freude über alles. Die 60 Tage schließen die Feiern der heiligen Zeit mit ein und enden nach dem Triduum paschale bzw. der vier heiligen Ostertage.
- Quinquagesimä tröstet mit dem Blick auf den Ostersonntagmorgen und die Auferstehung des Herrn, der in 50 Tagen gedacht wird.
- Quadragesimä führt uns tief in die Zeit der Buße und der Trauer, in der alle Hoffnungen auf das Kommen des Messias noch einmal aufflammen (Einzug in Jerusalem, letztes Abendmahl und Einsetzungsworte). Die Zeit endet am Gründonnerstag, unmittelbar mit oder vor dem Triduum Sacrum, den heiligen drei Tagen.
Dann, in 40 Tagen, gedenken wir der Passion Christi.
So, wie wir zunächst mit den vier Sonntagen schrittweise in die Zeiten hineingeführt wurden, so werden wir mit den jeweiligen Enden der Zeitspannen wieder Schritt für Schritt nach außen hin hinausgeführt.
E. Die Bedeutung der Sonntage für die christliche Lebenspraxis
Ähnlich den vier Sonntagen im Advent, in denen wir uns schrittweise, also wochenweise dem Tag der Geburt des Herrn im Kalender nähern, so haben auch die vier Sonntage Septuagesimä, Sexagesimä, Quinquagesimä und Quadragesimä die primäre Funktion unser Bewusstsein sukzessive, schrittweise, Woche für Woche auf die wichtigsten Ereignisse des Christentums zu lenken, auf Opfertod und Auferstehung Jesu.
Karfreitag und Ostersonntag sind die beiden höchsten Feiertage der Christenheit. Sich ihnen spirituell und mental anzunähern, um sich ihrer großen Bedeutung für das eigene Sein bewusst zu werden, ist mehr noch als in der Adventszeit mit Blick auf die Geburt des Herrn sicher wohl zu empfehlende Praxis.
Diese Annäherung wird fortgesetzt in den auf Quadragesimä (Invokavit) folgenden fünf Sonntagen, doch besteht der Unterschied darin, dass wir uns in diesen Wochen der Passionszeit innerhalb der vier Klammern befinden.
In der Lebenspraxis geht es dann weniger um den nach vorne gerichteten, tröstenden Blick als vielmehr darum, den Moment zu nutzen. Es geht darum, Buße und Vorbereitung (katholisch: Fasten) konkret zu gestalten. Es geht darum den Glauben zu vertiefen, das Vertrauen in die Macht Gottes zu stärken, die Erkenntnis des eigenen Seins im Angesicht der Schöpfung zu fassen.
Dennoch sind wir uns dessen bewusst, wovon die vier Sonntage kündeten: Für evangelische Christen stehen nicht das dramatische Leiden im Vordergrund, nicht die Selbstkasteiung, nicht um devote Unterwerfung, sondern das Happy End für jene, die daran glauben.
Und darum geht es: ICH glaube!
Anmerkungen:
[1] So ist es in der ![]() Legenda Aurea erklärt für die Zeitspannen Septuagesima (Seite 481), Sexagesima (Seite 487) und Quinquagesima (Seite 497).
Legenda Aurea erklärt für die Zeitspannen Septuagesima (Seite 481), Sexagesima (Seite 487) und Quinquagesima (Seite 497).
[2] Seit dem Kirchenjahr 2018/2019 ist die Sonntagsabfolge in den Zeiträumen nach Epiphanias und Vorpassion geändert. Während es früher in der Vorpassionszeit drei feste Sonntage gab, gibt es nun bis zu fünf Sonntage, die jedoch auch entfallen können. Das bedeutet: Der 3. Sonntag vor der Passionszeit (Septuagesimä) kann entfallen, nämlich dann, wenn Ostern vor dem 7. April liegt (Schaltjahr: 6. April).
[3] Eine genauere zeitliche und örtliche Angabe ist derzeit nicht möglich. Die vorliegenden Quellen berichten ohne zeitliche und regionale Verortung nur vom kirchlichen Gebrauch. So ![]() Grotefend im Glossar: »Septuagesima, Sonntag Circumdederunt, 9. Sonntag vor Ostern, und die mit ihm begonnene Fastenzeit der älteren Kirche.«
Grotefend im Glossar: »Septuagesima, Sonntag Circumdederunt, 9. Sonntag vor Ostern, und die mit ihm begonnene Fastenzeit der älteren Kirche.«
[4] Siehe ![]() Legenda Aurea, Seite 481: »Weil die heiligen Väter verfügt haben, daß wegen der Verehrung des Himmelfahrtstages, an dem unsere Natur in den Himmel aufstieg und über die Chöre der Engel erhoben wurde, jeweils der fünfte Wochentag (Donnerstag) feierlich begangen und dann kein Fasten eingehalten werden solle, denn in der alten Kirche war der Donnerstag gleich festlich wie der erste Wochentag (Sonntag). [...] Zum Ausgleich fügten die heiligen Väter eine Woche zur Fastenzeit hinzu und nannten sie Septuagesima.« Aus dieser Notiz lässt sich ableiten, dass ohne jene fastenfreie Donnerstage die Fastenzeit der Zeitraum von Sexagesimä bis Palmarum war oder gewesen wäre.
Legenda Aurea, Seite 481: »Weil die heiligen Väter verfügt haben, daß wegen der Verehrung des Himmelfahrtstages, an dem unsere Natur in den Himmel aufstieg und über die Chöre der Engel erhoben wurde, jeweils der fünfte Wochentag (Donnerstag) feierlich begangen und dann kein Fasten eingehalten werden solle, denn in der alten Kirche war der Donnerstag gleich festlich wie der erste Wochentag (Sonntag). [...] Zum Ausgleich fügten die heiligen Väter eine Woche zur Fastenzeit hinzu und nannten sie Septuagesima.« Aus dieser Notiz lässt sich ableiten, dass ohne jene fastenfreie Donnerstage die Fastenzeit der Zeitraum von Sexagesimä bis Palmarum war oder gewesen wäre.
[5] Siehe ![]() Legenda Aurea Seite 483: »Septuagesima stellt nämlich die 70 Jahre dar, in denen die Kinder Israels in der Babylonischen Gefangenschaft waren.«
Legenda Aurea Seite 483: »Septuagesima stellt nämlich die 70 Jahre dar, in denen die Kinder Israels in der Babylonischen Gefangenschaft waren.«
[6] Siehe ![]() Grotefend, Glossar »Allelujah claudere«: »Allelujah claudere, dimittere, sepelire, alleluja niderlegung bezeichnet den Sonntag Septuagesime oder den Sonnabend vorher, denn von diesem Tage, an welchem es zuletzt ertönte, wurde bis zum Osterfeste nach einer Bestimmung des Papstes Alexander II. von 1073 das Allelujah beim Gottesdienste nicht mehr angestimmt. [...] Zu gleicher Zeit waren auch alle öffentlichen Festlichkeiten (meyde, hochgezite) und auch die Hochzeiten verboten.«
Grotefend, Glossar »Allelujah claudere«: »Allelujah claudere, dimittere, sepelire, alleluja niderlegung bezeichnet den Sonntag Septuagesime oder den Sonnabend vorher, denn von diesem Tage, an welchem es zuletzt ertönte, wurde bis zum Osterfeste nach einer Bestimmung des Papstes Alexander II. von 1073 das Allelujah beim Gottesdienste nicht mehr angestimmt. [...] Zu gleicher Zeit waren auch alle öffentlichen Festlichkeiten (meyde, hochgezite) und auch die Hochzeiten verboten.«
[7] Siehe ![]() Legenda Aurea Seite 483: »Als ihnen Kyros dann später im 60. Jahr die Rückkehr erlaubte, begannen sie sich wieder zu freuen, und so singen auch wir am Karsamstag Alleluja, gleichsam im 60. Jahr, um ihre Freude nachzuahmen.«
Legenda Aurea Seite 483: »Als ihnen Kyros dann später im 60. Jahr die Rückkehr erlaubte, begannen sie sich wieder zu freuen, und so singen auch wir am Karsamstag Alleluja, gleichsam im 60. Jahr, um ihre Freude nachzuahmen.«
[8] Siehe ![]() Legenda Aurea Seite 483: »Aber am Samstag, mit dem Septuagesima endet, singen wir zwei Alleluja, um die volle Freude darzustellen, mit der sie in ihre Heimat kamen.«
Legenda Aurea Seite 483: »Aber am Samstag, mit dem Septuagesima endet, singen wir zwei Alleluja, um die volle Freude darzustellen, mit der sie in ihre Heimat kamen.«
[9] Der Sonntag Quasimodogeniti wurde daher in Urkunden auch als Sonntag »alleluja, alleluja, alleluja« bezeichnet. Siehe ![]() Grotefend, Glossar: »Dominica misse domini allelujah, allelujah, allelujah, 1. Sonntag nach Ostern, wo das Circumdederunt gelegte allelujah bei der Messe wieder aufgenommen wurde [...]. «
Grotefend, Glossar: »Dominica misse domini allelujah, allelujah, allelujah, 1. Sonntag nach Ostern, wo das Circumdederunt gelegte allelujah bei der Messe wieder aufgenommen wurde [...]. «
[10] Messbücher weisen nach, dass bereits in der Woche nach Ostersonntag das dreifache Halleluja in Messeingängen genutzt wurde und wird. Beispielhaft sei hier erwähnt aus dem Zisterzienser Missale (Ordo 1963), der ![]() Introitus zum Freitag in der Osterwoche: »Eduxit eos Dominus in spe, alleluja: et inimicos eorum operuit mare, alleluja, alleluja, alleluja. (Ganz sicher führte sie heraus der Herr, alleluja; doch ihre Feinde hat das Meer verschlungen, alleluja, alleluja, alleluja.)«.
Introitus zum Freitag in der Osterwoche: »Eduxit eos Dominus in spe, alleluja: et inimicos eorum operuit mare, alleluja, alleluja, alleluja. (Ganz sicher führte sie heraus der Herr, alleluja; doch ihre Feinde hat das Meer verschlungen, alleluja, alleluja, alleluja.)«.
[11] Siehe ![]() Grotefend, Glossar »Ostern«: »Eine besondere Verehrung genossen die vier ersten Tage der Osterwoche, vom Sonntag bis Mittwoch, die osterfeiertage oder vier hillige dage to paschen.«
Grotefend, Glossar »Ostern«: »Eine besondere Verehrung genossen die vier ersten Tage der Osterwoche, vom Sonntag bis Mittwoch, die osterfeiertage oder vier hillige dage to paschen.«
[12] Siehe ![]() Legenda Aurea Seite 487: »Weil Papst Melchiades und der heilige Silvester verfügten, man solle am Samstag zweimal essen, damit die Natur nicht wegen der Enthaltsamkeit geschwächt wird, die die Menschen am sechsten Wochentag (Freitag), wo man jederzeit fasten muß, auf sich genommen hatten. Zum Ersatz für die Samstage dieser Zeit fügten sie eine Woche zu Quadragesima hinzu und nannten sie Sexagesima.«
Legenda Aurea Seite 487: »Weil Papst Melchiades und der heilige Silvester verfügten, man solle am Samstag zweimal essen, damit die Natur nicht wegen der Enthaltsamkeit geschwächt wird, die die Menschen am sechsten Wochentag (Freitag), wo man jederzeit fasten muß, auf sich genommen hatten. Zum Ersatz für die Samstage dieser Zeit fügten sie eine Woche zu Quadragesima hinzu und nannten sie Sexagesima.«
[13] Siehe ![]() Legenda Aurea Seite 487.
Legenda Aurea Seite 487.
[14] Siehe ![]() Legenda Aurea Seite 487, 489, 491.
Legenda Aurea Seite 487, 489, 491.
[15] Siehe ![]() Legenda Aurea Seite 493.
Legenda Aurea Seite 493.
[16] Siehe ![]() Legenda Aurea Seite 493. Jacobus de Voragine bezieht auf das jüdische Erlassjahr, das Jubeljahr, das Halljahr. Siehe
Legenda Aurea Seite 493. Jacobus de Voragine bezieht auf das jüdische Erlassjahr, das Jubeljahr, das Halljahr. Siehe ![]() 3Mos 25,8-31.
3Mos 25,8-31.
[17] Siehe ![]() Legenda Aurea Seiten 493-495.
Legenda Aurea Seiten 493-495.
[18] Siehe ![]() Legenda Aurea Seiten 495.
Legenda Aurea Seiten 495.
[19] ![]() Grotefend, Glossar »Dominica quadragesime«: »Dominica quadragesime. Alleinstehend der erste Fastensonntag Invocavit. Indess wird unter quadragesima auch die ganze 40-tägige Fastenzeit verstanden und demnach die Sonntage gezählt dom. prima, secunda etc. quadrag.«
Grotefend, Glossar »Dominica quadragesime«: »Dominica quadragesime. Alleinstehend der erste Fastensonntag Invocavit. Indess wird unter quadragesima auch die ganze 40-tägige Fastenzeit verstanden und demnach die Sonntage gezählt dom. prima, secunda etc. quadrag.«
[20] Siehe ![]() Legenda Aurea Seiten 497.
Legenda Aurea Seiten 497.
[21] So findet sich beispielsweise auf ![]() katholisch.de im Artikel »70 statt 40 Tage: Warum manche Christen "vor-fasten"« der Text über Septuagesima und die Vorfastenzeit der katholischen Kirche bis zur Liturgiereform von 1969: »Exakt 70 Tage sind es nicht. Wer nachrechnet, wird feststellen, dass dafür eine ganze Woche fehlt. Vermutlich wurde ursprünglich die Osteroktav mitgerechnet: also die Zeit ab Ostersonntag, in der das Fest gewissermaßen auf acht Tage "gestreckt" wird. Nach anderer Auffassung handelt es sich bei der 70 lediglich um eine aufgerundete Zahl, die symbolischen Charakter hat. Von einer Aufrundung zeugt auch der Name des zweiten Sonntags der Vorfastenzeit: "Sexagesima" ("der sechzigste"), der eigentlich 56 Tage vor Ostern liegt.«
katholisch.de im Artikel »70 statt 40 Tage: Warum manche Christen "vor-fasten"« der Text über Septuagesima und die Vorfastenzeit der katholischen Kirche bis zur Liturgiereform von 1969: »Exakt 70 Tage sind es nicht. Wer nachrechnet, wird feststellen, dass dafür eine ganze Woche fehlt. Vermutlich wurde ursprünglich die Osteroktav mitgerechnet: also die Zeit ab Ostersonntag, in der das Fest gewissermaßen auf acht Tage "gestreckt" wird. Nach anderer Auffassung handelt es sich bei der 70 lediglich um eine aufgerundete Zahl, die symbolischen Charakter hat. Von einer Aufrundung zeugt auch der Name des zweiten Sonntags der Vorfastenzeit: "Sexagesima" ("der sechzigste"), der eigentlich 56 Tage vor Ostern liegt.«
[22] Siehe ![]() Grotefend, Glossar »Quadragesima Martini«: »Quadragesima Martini oder parva, die Adventszeit vom 14. Nov. ab bis Weihnachten [...] Die quadr. Mart, war nur der älteren Kirche eigen.«
Grotefend, Glossar »Quadragesima Martini«: »Quadragesima Martini oder parva, die Adventszeit vom 14. Nov. ab bis Weihnachten [...] Die quadr. Mart, war nur der älteren Kirche eigen.«