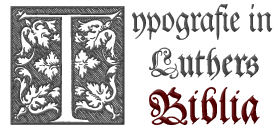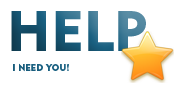Sonntag Lätare
Sonntag, 19. März 1950

QuickInfo
Eisenacher Ordnung
| 1. Evangelium | |
| 1. Epistel | |
| 2. Evangelium | |
| 2. Epistel | |
| Alttestamentliche Lektion | |
In den Landeskirchen galten zwischen 1958/1959 und 1978/1979 unterschiedliche Textordnungen.
Wahl der Kirchenordung | ||
Altkirchliche | Eisenacher aktuelle Ansicht | |
| ||
Wir zeigen in den Kirchenjahren ab 1898/1899 bis 1977/1978 die in jener Zeit maßgeblichen Leseordnungen.
Im Kirchenjahr 1949/1950 galten bevorzugt:
- I. Altkirchliche Ordnung:
Die Ordnung für Landeskirchen, die nach wie vor der altkirchlichen Textordnung folgten (seit Beginn der Reformation gültig; so die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg). - II. Eisenacher Ordnung:
Die Ordnung für Landeskirchen, die den Empfehlungen der Eisenacher Konferenz folgten (seit dem Kirchenjahr 1898/1899 verfügbar; so die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau).
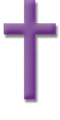
Das evangelische Kirchenjahr
nach der Leseordnung der Eisenacher Konferenz

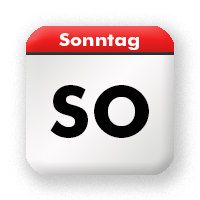
Sonntag
Lätare
Violett
4. Sonntag in der Fasten
Fastenzeit
Inhalt dieser Seite
- Allgemeiner Teil
- 1. Der Sonntag Lätare in den Jahren 1950 bis 1957
- 2. Bewegliches Datum im Kalender
- 3. Der Name Lätare
- Gottesdienstordnung
nach der Leseordnung der Eisenacher Konferenz - 4. Der Sonntag Lätare in der gottesdienstlichen Ordnung
- 5. Die Perikopen aus der Lutherbibel von 1545
- Hörbuch-Video
- 6. Die Speisung der Fünftausend
- 7 Die frohe Botschaft (Jes 52,7-10)
- Anhänge
- 8. Zum Gebrauch der Perikopen
- 9. Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Bibeltextes
- 10. Empfehlungen
Der Lätare in den Kirchenjahren 1949/1950 bis 1956/1957
Verweise führen zu den Kalenderblättern des jeweiligen Datums:

- 3. Sonntag vor
 Ostern
Ostern - 4. Sonntag in der Fasten
- Abhängig vom
 Osterdatum
Osterdatum
Lätare liegt zwischen dem 1. März und dem 4. April eines Jahres

- 21 Tage vor Ostern
- gerechnet ab diesem Tag ist am 22. Tag Ostern
Der Name Lätare
»Juble!«
laetare: sich freuen
laetare: Freue dich!; Juble!
Der Name Lätare geht zurück auf die vorreformatorische Zeit und leitet sich ab vom ersten Wort des lateinischen Introitus der römisch-katholischen Messe für diesen Sonntag (»Laetare cum Jerusalem, et exsultate in ea, omnes qui diligitis eam«). Er hat sich in den evangelischen Kirchen als Name für den 4. Sonntag der Passionszeit bis heute erhalten.
Biblisch stützt sich die Bezeichnung Lätare auf das erste Wort im Text Jesaja 66,10.
Hier der Text Jes 66,10 aus der lateinischen Biblia Sacra Vulgata und aus Luthers Biblia von 1545:
6610 laetamini cum Hierusalem et exultate in ea omnes qui diligitis eam gaudete cum ea gaudio universi qui lugetis super eam
6610 FRewet euch mit Jeruſalem / vnd ſeid frölich vber ſie / alle die jr ſie lieb habet / Frewet euch mit jr / alle die jr vber ſie trawrig geweſen ſeid.
Die mittelalterlichen Bezeichnungen
Dominica Hierusalem
Die Bezeichnung Dominica Hierusalem, Sonntag Jerusalem oder Jerusalemsonntag, stützt sich wie die heutige Bezeichnung auf den Messeingang dieses Sonntags aus Jesaja 66,10 (s.o.).
Dominica de rosa
Weitere Bezeichnungen
für den Sonntag Lätare waren:
- Dominica de rosa
- Dominica de rose
- Dominica de rosata
Sie bedeuten Rosensonntag.
Die goldene Rose war eine päpstliche Auszeichnung, die jährlich einer Persönlichkeit, einem Staat, einer Stadt oder einer Organisation verliehen wurde. Dies geschah »up mittevasten«, an Mittfasten, genauer: am Sonntag Lätare.
Belegt scheint, dass erstmals Papst Urban II. im Jahr 1069 eine solche Rose als Auszeichnung fertigen ließ. Die Bezeichnung Dominica de rosa wird somit frühestens ab dem späten 11. Jahrhundert anzunehmen sein.
Im Jahr 1519 wurde eine Rose an Friedrich den Weisen, Kurfürst von Sachsen, vergeben, womit ihn Papst Leo X. wohl ermuntern wollte, für die römisch-katholische Kirche einzustehen und die Lehren Luthers zu unterdrücken.
Unsere Kalender verwenden die vorreformatorischen Bezeichnungen bis zum Jahr 1530 (Verlesung der ![]() Confessio Augustana, des Augsburgischen Bekenntnisses).
Confessio Augustana, des Augsburgischen Bekenntnisses).
Gottesdienstliche Ordnungen

Der evangelische
Sonntag
Lätare
4. Sonntag in der Fasten
nach der Leseordnung der Eisenacher Konferenz
![]() in unierten und reformierten Landeskirchen überwiegend gültig in den Jahren 1898/1899 bis 1977/1978
in unierten und reformierten Landeskirchen überwiegend gültig in den Jahren 1898/1899 bis 1977/1978
![]() in lutherischen Landeskirchen überwiegend gültig in den Jahren 1898/1899 bis 1956/1957
in lutherischen Landeskirchen überwiegend gültig in den Jahren 1898/1899 bis 1956/1957
Liturgische Farbe
Violett
Thema des Sonntags
(nach dem Evangeliumstext Joh 6,1-15 )
Die Speiſung der Fünftauſend
Spruch und Psalm für die Woche
Es ſey denn / das das Weitzenkorn in die erden falle / vnd erſterbe / ſo bleibts alleine. Wo es aber erſtirbet / ſo bringets viel Früchte.
Lied für die Woche
| EG alt | EG neu | Titel |
|---|---|---|
| 293 | EG 396 | Jeſu, meine Freude |
EG: Evangelisches Gesangbuch
EG alt: Nummer des Liedes in alten Evangelischen Gesangbüchern
EG neu: Nummer des Liedes im neuen Evangelischen Gesangbuch (ab 2013)
Die biblischen Texte für Lesung und Predigt
| Reihe | Inhalt | Text für die Predigt |
|---|---|---|
| Reihe I: altkirchliche Reihe | Epistel | |
| Evangelium | | |
| Reihe II | 2. Epistel | |
| 2. Evangelium | ||
| alttestamentliche Reihe | Alttestamentliche Perikope | |
Aufbau der Leseordnung
Die Eisenacher Konferenz (eine Konferenz der evangelischen Landeskirchen Deutschlands) erarbeitete in den Jahren von 1888 bis 1896 eine Perikopenordnung für die evangelischen Kirchen. Sie verstand die altkirchlichen Perikopen (Epistel und Evangelium) als eine erste Reihe und fügte ihnen in einer zweiten Reihe einen zweiten Text aus den Episteln und einen zweiten Text aus den Evangelien hinzu. Die große Besonderheit dieser Ordnung war die Einführung einer dritten, alttestamentlichen Reihe, die für jeden Sonntag des Kirchenjahres erstmals einen alttestamentlichen Text bot. Die Verwendung dieser Perikopen geschah nicht einheitlich. Gedacht waren sie dazu, sie wechselweise im Gottesdienst zu verwenden, so innerhalb einer Folge von vier Jahren:
- im 1. Jahr: altkirchliches Evangelium und altkirchliche Epistel
- im 2. Jahr: 2. Evangelium und Lektion Altes Testament
- im 3. Jahr: altkirchliches Evangelium und altkirchliche Epistel
- im 4. Jahr: 2. Evangelium und 2. Epistel
Damit ergab sich für die Lesungen ein Zyklus von vier Jahren und für die Predigt, die sich jeweils auf die Evangelienperikope stützte, ein Zyklus von zwei Jahren.
Altkirchliche Textordnung in Landeskirchen
In einigen Landeskirchen, darunter die evangelische Kirche Brandenburgs, galt in dieser Zeit weiterhin die altkirchliche Textordnung. Sie kennt nur Evangelium und Epistel (Reihe I in der Eisenacher Textordnung), die beide nach wie vor für die Textlesung sowie für die Predigt im Haupt- und Abendgottesdienst empfohlen waren.
Die evangelische Kirche Württembergs
Die evangelische Kirche Württembergs nutzte in dieser Zeit eine Perikopenordnung, die sich auf einen Dreijahreszyklus stützte. Über die drei Jahrgänge hinweg fanden sich die Perikopen wie hier genannt, allerdings in anderer Anordnung und ergänzt um weitere Perikopen, die weder in altkirchlichen Ordnungen noch in der neuen Eisenacher Ordnung bekannt waren.
Diese Ordnung der evangelischen Kirche Württembergs ist derzeit hier nicht wiedergegeben.
Geschichtliche Anmerkungen: Die Eisenacher Perikopen in Zeiten des Umbruchs
- In den Jahren des nationalsozialistischen Regimes gab es im Zusammenhang mit der brachialen antisemitischen Ausrichtung in Politik und Gesellschaft in den evangelischen Kirchen regional Intentionen, die alttestamentliche Reihe abzuschaffen und die anderen Reihen im Sinne einer Staatsräson zu korrigieren. Dieses Ansinnen wirkte trotz einer Bekennenden Kirche vereinzelt bis weit die Zeit nach dem 2. Weltkrieg nach.
- Auch nach der Vereinigung von Landeskirchen, wie der Gründung von VELKD und EKD, blieben die Ordnungen der Predigttexte den Synoden der Landeskirchen unterworfen und entwickelten sich somit zunehmend uneinheitlich.
- Ab dem Jahr 1957/1958, spätestens ab 1960/1961 galt dann in den meisten evangelisch-lutherischen Kirchen eine neue Perikopenordnung auf Basis von sechs Reihen, weil sich nun erstmals nach Eisenach über Jahre hinweg eine landeskirchlich übergreifende und unabhängige Konferenz (Lutherische Liturgische Konferenz Deutschlands) mit liturgisch-homiletischen Fragen beschäftigte und 1957 Antworten in Form einer »Ordnung der Predigttexte« vorlegte.
- Doch die Entscheidungshoheit oblag nach wie vor den landeskirchlichen Synoden. Überwiegend unierte und reformierte Landeskirchen nutzten die hier vorliegende Ordnung der Predigttexte nach dem Eisenacher Schema weiterhin bis 1977/1978 oder auch darüber hinaus.
- Bis heute gilt in manchen evangelischen Kirchen und Freikirchen eine Ordnung auf Grundlage der Eisenacher Perikopen im vierjährigen Zyklus.
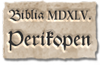
Perikopen nach Luther 1545
Lätare
Perikopen
Texte für Lesungen und Predigt
Texte nach der Lutherbibel von 1545 gesetzt nach der Vorlage des Originals in Frakturschrift mit Luthers Scholion und Verweisen in den Marginalspalten. Ergänzt um Verszählung und Abschnittsüberschriften.
LESUNG UND PREDIGTTEXT
Evangelium
Evangelium nach Johannes
Joh 6,1-15
Text hören:
Sprecher: R. Makohl | Musik: ©Bluevalley, J.S. Bach
Das Verzeichnis der Hörbuch-Videos mit den Lesungen des Evangeliums finden Sie hier:
![]() ↦ Video-Hörbuch
↦ Video-Hörbuch

Euangelium
S. Johannes.
C. VI.
IHeſus fuhr weg vber das Meer an der ſtad Tiberias in Galilea / 2vnd es zoch jm viel Volcks nach / darumb das ſie Zeichen ſahen / die er an den Krancken thet. 3Jheſus aber gieng hin auff / auff einen Berg / vnd ſatzte ſich daſelbs mit ſeinen Jüngern. 4Es war aber nahe die Oſtern der Jüden Feſt.
DA hub Jheſus ſeine augen auff / vnd ſihet / das viel Volcks zu jm kompt / vnd ſpricht zu Philippo / Wo keuffen wir Brot / das dieſe eſſen? 6Das ſaget er aber jn zuuerſuchen / Denn er wuſte wol / was er thun wolte. 7Philippus antwortet jm / Zwey hundert pfennig werd Brots iſt nicht gnug vnter ſie / das ein jglicher ein wenig neme. 8Spricht zu jm einer ſeiner Jünger / Andreas der bruder Simonis Petri / 9Es iſt ein Knabe hie / der hat fünff gerſten Brot / vnd zween Fiſche / Aber was iſt das vnter ſo viele? 10Jheſus aber ſprach / Schaffet das ſich das Volck lagere. Es war aber viel Gras an dem ort. Da lagerten ſich bey fünff tauſent Man. 11Jheſus aber nam die Brot / dancket / vnd gab ſie den Jüngern / Die Jünger aber denen / die ſich gelagert hatten. Deſſelbigen gleichen auch von den Fiſchen / wie viel er wolte.
12DA ſie aber ſat waren / ſprach er zu ſeinen Jüngern / Samlet die vbrigen Brocken / das nichts vmbkome. 13Da ſamleten ſie / vnd fülleten zwelff Körbe mit Brocken / von den fünff gerſten Brot / die vberblieben / denen / die geſpeiſet worden. 14Da nu die Menſchen das Zeichen ſahen / das Jheſus that / ſprachen ſie / Das iſt warlich der Prophet / der in die Welt komen ſol. 15Da Jheſus nu mercket / das ſie komen würden / vnd jn haſchen / das ſie jn zum Könige machten / entweich er abermal / auff den Berg / er ſelbs alleine.
![]()
✽
LESUNG UND ZWEITER PREDIGTTEXT
Epistel
Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom
Rom 5,1-11
REIHE
EP

Die Epiſtel S. Pauli:
An die Römer.
C. V.
Verse 1 - 11
Friede mit Gott durch Jesus Christus
Paulus schreibt:
NV wir denn ſind gerecht worden durch den glauben / So haben wir Friede mit Gott / durch vnſern HErrn Jheſu Chriſt / 2Durch welchen wir auch einen Zugang haben im glauben / zu dieſer gnade / darinnen wir ſtehen / vnd rhümen vns der Hoffnung der zukünfftigen Herrligkeit / die Gott geben ſol. 3Nicht allein aber das / Sondern wir rhümen vns auch der Trübſaln / die weil wir wiſſen / Das trübſal gedult bringet / 4Gedult aber bringet erfarung / Erfarung aber bringet hoffnung. 5Hoffnung aber leſſt nicht zu ſchanden werden. Denn die liebe Gottes iſt ausgegoſſen in vnſer hertz durch den heiligen Geiſt / welcher vns gegeben iſt.
(Erfarung)
Erfarung iſt / wenn einer wol verſucht iſt / vnd kan dauon reden / als einer der dabey geweſen iſt.
6DEnn auch Chriſtus / da wir noch ſchwach waren nach der zeit / iſt fur vns Gottloſen geſtorben. 7Nu ſtirbet kaum jemand vmb des Rechtes willen. Vmb etwas Gutes willen thürſte vieleicht jemand ſterben. 8Darumb preiſet Gott ſeine Liebe gegen vns / das Chriſtus fur vns geſtorben iſt / da wir noch Sünder waren. 9So werden wir je viel mehr durch jn behalten werden fur dem zorn / nach dem wir durch ſein Blut gerecht worden ſind.
10DEnn ſo wir Gott verſünet ſind / durch den Tod ſeines Sons / Da wir noch Feinde waren / Viel mehr werden wir ſelig werden durch ſein Leben / ſo wir nu verſünet ſind? 11Nicht allein aber das / ſondern wir rhümen vns auch Gottes / durch vnſern HErrn Jheſum Chriſt / durch welchen wir nu die Verſünung empfangen haben.
(Gottes)
Das Gott vnſer ſey / vnd wir ſein ſeien / vnd alle Güter gemein von jm vnd mit jm haben / in aller zuuerſicht.
![]()
✽
LESUNG
ALTES TESTAMENT
Buch des Propheten Jesaja
Jes 52,7-10
Text hören:
Sprecher: R. Makohl | Musik: ©Bluevalley, J.S. Bach
Das Verzeichnis der Hörbuch-Videos mit den Lesungen des Evangeliums finden Sie hier:
![]() ↦ Video-Hörbuch
↦ Video-Hörbuch

Der Prophet
Jeſáiá.
C. LII.
Verse 7 - 10
Die frohe Botschaft
WIe lieblich ſind auff den Bergen die füſſe der Boten / die da Friede verkündigen / Guts predigen / Heil verkündigen / Die da ſagen zu Zion / Dein Gott iſt König. 8Deine Wechter ruffen laut mit jrer Stim / vnd rhümen miteinander / Denn man wirds mit augen ſehen / wenn der HERR Zion bekeret. 9Laſſet frölich ſein vnd miteinander rhümen das wüſte zu Jeruſalem / Denn der HERR hat ſein Volck getröſtet vnd Jeruſalem gelöſet. 10Der HERR hat offenbart ſeinen heiligen Arm fur den augen aller Heiden / Das aller Welt ende ſihet das Heil vnſers Gottes.
![]()
✽
Die Speisung der Fünftausend
Hörbuch-Video zur Biblia 1545
 Hörbuch-Video: Joh 6,1-15
Hörbuch-Video: Joh 6,1-15
Das Video zeigt den Text der Geschichte aus der Lutherbibel von 1545, in der Jesus 5000 Zuhörer seiner Predigten speist, vorgelesen von Reiner Makohl.
Die frohe Botschaft (Jes 52,7-10)
Hörbuch-Video zur Biblia 1545
 Hörbuch-Video: Jes 52,7-10
Hörbuch-Video: Jes 52,7-10
Das Video zeigt den Text der Erzählung aus der Lutherbibel von 1545, in der von der frohen Botschaft für alle Gläubigen berichtet wird, vorgelesen von Reiner Makohl.
»Frewet euch mit den Frölichen /
vnd weinet mit den Weinenden.
Habt mit allen Menſchen Friede.«
Zum Gebrauch
Der Rückblick auf die Perikopenordnungen vergangener Jahrhunderte zeigt auf, wie sich die Verwendung der biblischen Texte in evangelischen Gottesdiensten im Laufe der Zeit veränderte.
Wir beschränken uns in den weit zurückliegenden Jahren auf Perikopenordnungen, die überwiegend in Gebrauch waren.
Durch die neue Ordnung für die Verwendung von Sprüchen, Psalmen, Bibeltexten und Liedern in Gottesdiensten sind die alten Ordnungen zwar liturgisch überholt, aber inhaltlich deswegen keineswegs falsch.
Wir möchten Sie daher ermuntern, die in alter Zeit verwendeten Perikopen zu betrachten. Nur so können Sie ergründen, ob das, worauf sich Pfarrer vor Hunderten von Jahren in Gottesdienst und Predigt stützten, auch noch heute aktuell ist. Aktuell für Sie ganz persönlich.

™Hinweise zur Stilkunst.de-Ausgabe
Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Bibeltextes
Der Text aus der Lutherbibel ist auf unseren Seiten in Anlehnung an das Druckbild des Originals von 1545 wiedergegeben.
Den Seitenaufbau, die verwendeten Schriften, die Schreibregeln der Frakturschrift und Luthers Intentionen, mit der Typografie Lesehilfen bereitzustellen, erläutert dem interessierten Leser unser Artikel »Satz und Typografie der Lutherbibel von 1545«.
Infos. Fakten. Wissen.
 Wann ist Ostern?
Wann ist Ostern?
Die beweglichen Feiertage im Jahreslauf hängen ab vom Osterdatum. Der Artikel erläutert, wie sich das Osterdatum berechnet und nennt die aktuellen Daten der Feiertage.
/Preview-Joh_6(1-15).png)
/Preview-Jes_52(7-10).png)