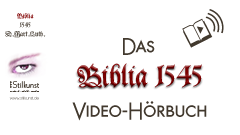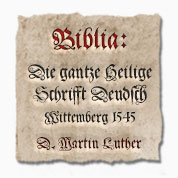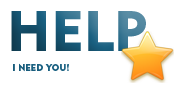Johannes 12,20-26
Das Hörbuch-Video zur Lutherbibel von 1545
Hörbuch-Video zur Lutherbibel von 1545
Hörbuch-Video
Das Ende des öffentlichen Wirkens Jesu
Die Verherrlichung Jesu naht
Evangelium nach Johannes
12,20-26
vorgelesen von Reiner Makohl
Gedanken zum Text
Evangelium nach Johannes
Kapitel 12, Verse 20-26
Das Ende des öffentlichen Wirkens Jesu
Die Verherrlichung Jesu naht
Einleitung
Die heutige evangelische Theologie liest Johannes 12,20-26 im Kontext von Jesu Weg ans Kreuz und als Aufruf zu einem Leben im Vertrauen auf Gottes Wirken.
Inhalte und Botschaften
Verse 20-21: Die Begegnung mit den Griechen
Betrachtet man den historischen Hintergrund, dann dokumentiert diese Notiz über die Griechen, dass Jesus im Gebiet des Herodes Philippus unterwegs war, in der Dekopolis, im Ostjordanland. Dort gab es nur wenige Juden, aber viele Griechen. Die Gründe für Jesu Aufenthalt dort waren einfach: Jesus zog sich immer wieder in Gebiete zurück, die einen gewissen Schutz vor Verfolgung boten. War er doch auch längst in Galiläa verfolgt von den dortigen Pharisäern und von Herodes Antipas, der schon Johannes den Täufer hinrichten ließ.
Die Bevölkerung im Ostjordanland hatte von Jesus gehört und wurde neugierig. So kam es, dass Griechen diesen Jesus von Nazareth kennenlernen wollten, nachdem sie erfahren hatten, dass Jesus in der Gegend war.
Die folgenden Jesu-Worte sind jedoch keine Antwort Jesu an die Griechen. Sie stehen allgemeingültig. Der Perikopenschnitt ist daher nicht zufriedenstellend. Die beiden Verse tragen nichts zum Verständnis der folgenden Jesu-Worte bei.
Dennoch stehen in der modernen Theologie jene Griechen, die nach Jesus fragen, für die Öffnung des Evangeliums über das Volk Israel hinaus. Jesus ist nicht nur für eine bestimmte Gruppe gekommen, sondern für die ganze Welt – ein Kernthema der evangelischen Theologie.
Aber der Evangelist gibt keine Antwort darauf, ob Jesus wirklich die Griechen auf deren Bitte hin getroffen hatte. Seine Worte richtete er ja an Philippus und Andreas. Der Text lässt eher vermuten, dass Jesus die Begegnung mit den Griechen vermieden hatte. Er war nicht darauf aus, mit ihnen in ein theologisches Gespräch zu geraten zwischen jüdischem Glauben und hellenistischer Götterwelt, oder gar in der Not zu sein, sich als universaler Messias der fremden Religion gegenüber beweisen zu müssen. Zumindest berichten weder diese Erzählung noch die Evangelien in Gänze davon.
Aus der Sicht der Griechen stellten die Jesu-Worte auch ganz sicher keinen Aufhänger für ein Gespräch mit Jesus dar. Die Griechen wären wohl höchst irritiert gewesen, wenn Philippus und Andreas ihnen diese Worte als Antwort auf die Bitte, Jesus sehen zu wollen, gegeben hätten.
Die Interpretation dieser Verse als Beleg für Jesu Öffnung des Evangeliums hin zu allen Völkern ist sicher nicht haltbar. Die Öffnung des Evangeliums für Nicht-Juden ist erst nach Jesu Kreuzigung vor allem durch Paulus umgesetzt worden. Sie entspring paulinischer, aber eben nicht jesuanischer Lehre.
Vers 23: Der Wendepunkt in Jesu Leben
Die »Stunde« steht für Kreuz und Auferstehung. Jesus deutet an, dass seine Herrlichkeit nicht in Macht und Ruhm liegt, sondern in seinem Leiden, Sterben und Auferstehen.
Jesus spricht von seinem Tod als einem notwendigen Schritt zur Verherrlichung. Doch das ist nicht einfach ein zukünftiges Ereignis, sondern ein existenzielles Geschehen im Glauben. Der Tod Jesu offenbart Gottes Heilswirken im Hier und Jetzt.
Vers 24: Das Weizenkorn als Bild
Das Sterben des Weizenkorns ist eindeutig als Bild für Jesu Tod und dessen lebensspendende Kraft zu verstehen. Doch dieses Bild ragt weit über die Person Jesu hinaus.
Das Korn muss sterben, um Frucht zu bringen. Das bedeutet: Der Mensch muss seine alte, selbstbezogene Existenz aufgeben (Sterben des alten Selbst) und im Glauben eine neue Existenz gewinnen.
Evangelisch bedeutet es: Leben entsteht, wo Menschen sich hingeben, Liebe leben und Vertrauen auf Gott setzen.
Verse 25 und 26: Die Entscheidung für das Leben
Jesus spricht: »Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren; und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es bewahren zum ewigen Leben. Wenn einer mir dienen will, so folge er mir nach; und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren.«
Diese Worte sind nicht als moralische Handlungsanweisung oder als Aufforderung zum Selbsthass zu verstehen, sondern als Aufruf zur Entscheidung. Das »Leben in dieser Welt« steht für die menschliche Existenz, die sich an das Materielle und Vergängliche klammert. Wer sein Leben »liebt« (also an dieser Welt festhält), wird es verlieren, weil alles Weltliche vergänglich ist. Wer aber sein Leben »hasst« – im Sinne von Loslassen und Vertrauen auf Gott –, der gewinnt das wahre, ewige Leben.
Es geht um eine Entscheidung zur wahren Existenz: Der Glaube bedeutet, sein Leben aus der Hand zu geben und sich auf das göttliche Wort einzulassen. Das »Dienen« in Vers 26 ist nicht ein äußeres Werk, sondern die Entscheidung für den Glauben, durch die man wirklich in die Gemeinschaft mit Jesus tritt (»wo ich bin, da wird auch mein Diener sein«).
Zusammenfassung
Die Verse 20 und 21 stellen eine gesondert zu betrachtende Erzählung dar, die nicht zu den folgenden Jesu-Worten passen und in einen eigenen Verkündigungskontext gehören.
Die Verse 21 bis 24 zeigen zwar klar den Hinweis auf Jesu Leiden, Sterben und Auferstehung, als Botschaft in unsere Zeit hinein sind sie aber eine Forderung Jesu an uns, die uns existenziell im Kern (das metaphorische Weizenkorn) unseres Lebens trifft: Wer sich auf den Glauben an Christus einlässt, tritt in eine neue, wahre Existenz ein – das ist die eigentliche »Verherrlichung« Gottes.
Die Verse 25-26 sind als Aufruf zur Entscheidung zu verstehen: Wer sich an das irdische Leben klammert, verliert es; wer es im Vertrauen auf Gott loslässt, findet wahre Existenz.
Die evangelische Verkündigung betont besonders Nachfolge, Verantwortung und Vertrauen auf Gottes Handeln.
| Perikope | Typ | Tag |
|---|---|---|
| 1531 - 1898 | ||
Keine Verwendung an Sonntagen, Feiertagen und Gedenktagen | ||
| 1899 - 1978 | ||
Joh 12,20-26 | 2. Evangelium | |
| Lutherische Kirchen 1958-1978 | ||
Keine Verwendung an Sonntagen, Feiertagen und Gedenktagen | ||
| 1979 - 2018 | ||
Joh 12,20-26 | Evangelium | |
| seit 2019 | ||
Joh 12,20-24 | Evangelium | |
VERSE AUS DEM TEXT IN LITURGISCHEN TAGES- UND WOCHENSPRÜCHEN
| Vers / Typ | Text | Tag |
|---|---|---|
| 1531 - 1898 | ||
Joh 12,24b | Es sei denn, daß das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. | |
Wochenspruch | ||
| 1899 - 1978 | ||
Joh 12,24b | Es sei denn, daß das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. | |
Wochenspruch | ||
| Lutherische Kirchen 1958-1978 | ||
Joh 12,24b | Es sei denn, daß das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. | |
Wochenspruch | ||
| 1979 - 2018 | ||
Joh 12,24b | Es sei denn, daß das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. | |
Wochenspruch | ||
| seit 2019 | ||
Joh 12,24b | Es sei denn, daß das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. | |
Wochenspruch | ||
Hörbuch-Videos zur Biblia 1545
 Übersicht der Hörbuch-Videos
Übersicht der Hörbuch-Videos
Frakturschrift ist nicht leicht zu lesen. Die Videos zeigen ausgewählte Texte aus der Lutherbibel von 1545, vorgelesen von Reiner Makohl.
Zum Gebrauch
Die Lutherbibel von 1545 ist mit ihrem Frakturzeichensatz nicht leicht zu lesen. Wir bieten Videos, in denen ausgewählte Perikopen aus den Sonn- und Feiertagsreihen vorgelesen werden.
Wir empfehlen, die Videos im Vollbildmodus zu genießen.
Credits zum Video:
©2024 by Reiner D. Makohl | www.stilkunst.de
Bibeltexte: Dr. Martin Luther, Biblia, Wittenberg 1545
Zeichensätze der Frakturschriften, Typografie & Layout,
Video: Reiner D. Makohl
Sprecher: Reiner D. Makohl
Musik: ©Bluevalley, J.S.Bach, Präludium in C-Dur, Gitarre
.png)