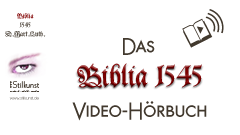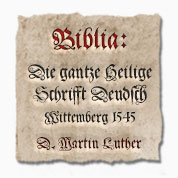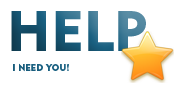Matthäus 4,1-11
Das Hörbuch-Video zur Lutherbibel von 1545
Hörbuch-Video zur Lutherbibel von 1545
Hörbuch-Video
Taufe und Versuchung Jesu
Die Versuchung Jesu
Evangelium nach Matthäus
4,1-11
vorgelesen von Reiner Makohl
Gedanken zum Text
Evangelium nach Matthäus
Kapitel 4, Verse 1-11
Taufe und Versuchung Jesu
Die Versuchung Jesu
Einleitung
Der Text Matthäus 4,1-11 beschreibt die Versuchung Jesu in der Wüste und zeigt, wie Jesus den Angriffen des Teufels widersteht.
Inhalte
Verse 1 - 2: Die Versuchung als Prüfung
Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt – ein Ort der Einsamkeit, aber auch der Gottesbegegnung. Er fastet 40 Tage und wird körperlich schwach.
Die drei Versuchungen, die Jesus verführen wollen, den Glauben an Gott zu verlieren, erscheinen in der Erzählung personifiziert als der Teufel, als Versucher. Die Geschichte lebt von der dramatischen Begegnung des Menschen Jesus mit der göttlichen, mythischen Gestalt des Teufels.
Das 40-tägige Fasten in der Wüste als Ort der Gottesbegegnung ist ein klarer und bedeutsamer Bezug auf Mose, der 40 Tage auf dem Berg Horeb fastete, wie mehr fach in der Bibel erwähnt.
Jesus zitiert in seiner Rede gegen den Versucher ausschließlich aus dem 5. Buch Mose. Dort ist der Kontext zu suchen und daher sei die Belegstelle zum Fasten des Mose auch aus dem 5. Buch Mose entnommen:
»Denn am Horeb erzürntet ihr den HERRN so, dass er vor Zorn euch vertilgen wollte, als ich auf den Berg gegangen war, die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der HERR mit euch schloss, und ich vierzig Tage und vierzig Nächte auf dem Berge blieb und kein Brot aß und kein Wasser trank und mir der HERR die zwei steinernen Tafeln gab, mit dem Finger Gottes beschrieben, und darauf alle Worte, die der HERR mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet hatte am Tage der Versammlung.« (5Mos 9,8-10; Lutherbibel 2017)
Mose hatte die Gebote empfangen, Jesus bestätigt ihre Wirksamkeit und Bedeutung für den standhaften Glauben
Verse 3 - 10: Drei Versuchungen
- Brot (Vers 3-4): Der Teufel fordert Jesus auf, Steine in Brot zu verwandeln – eine Versuchung, seine göttliche Macht egoistisch zu nutzen. Doch Jesus antwortet mit Gottes Wort: »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein« (5. Mose 8,3).
- Macht (Verse 5-7): Der Teufel fordert Jesus heraus, sich von der Tempelzinne zu stürzen – ein spektakulärer Beweis seiner Göttlichkeit. Jesus lehnt ab: Gott vertrauen heißt nicht, ihn herauszufordern.
- Reichtum und Herrschaft (Verse 8-10): Der Teufel bietet Jesus alle Reiche der Welt, wenn er ihn anbetet. Doch Jesus bleibt Gott treu: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen« (5. Mose 6,13).
Zusammenfassung
Jesus zeigt, wie wir Versuchungen widerstehen können: durch Gottes Wort, Vertrauen und Gehorsam. Das sagt sich so leicht, ist es aber nicht. Wir scheitern oft.
Die drei Versuchungen sprechen Themen an, die für uns in unserem irdischen Dasein von großer Bedeutung sind, weshalb wir den Verführungen darin leicht erliegen können. Aber wer sich auf Gottes Wort gründet, bleibt standhaft.
Vorwort zu den folgenden Textabschnitten
Die Perikope Mt 4,1-11 ist theologisch hoch interessant. Es bestehen viele Möglichkeiten der Betrachtung für eine Auslegung. So erklärte schon D. Martin Luther in seiner Predigt vom 18.2.1532 (Sonntag Invokavit) über die Perikope Mt 4,1-11:
»Dies Evangelium soll wohl leicht sein, aber wir machen’s selber schwer. Denn auch die, die es hören, hören‘s nicht gern. Es wird je länger je schwerer zu predigen, man lässt das edle Wort vorüberrauschen wie die Elbe. Dennoch wollen wir’s unserm Herrgott zulob predigen. Tun wir’s nicht, so tut er’s selber.«
(Quelle der Nachschrift Röhrers: ![]() WA 36, 118,2-5; deutsche Übersetzung in
WA 36, 118,2-5; deutsche Übersetzung in ![]() LU-Predigt, Band 2, S. 24)
LU-Predigt, Band 2, S. 24)
Beispielhaft möchte ich hier drei verschiedene Interpretationen anreißen, die grundlegend verschiedene theologische Konzepte repräsentieren.
- Ein erster Auslegungsversuch soll von einer Theologie ausgehen, der in der Verkündigung die Aspekte »Hoffnung«, »Erlösung im und durch das Kreuz« und des »Reichs Gottes« zugemessen werden.
- Eine zweite Auslegung soll von einer Theologie ausgehen, die die Perikope als politische und sozialethische Erzählung auffasst.
- Eine dritte Auslegung geht von einer existenzialen Theologie aus, die zudem die durch mythische Bilder der Antike gezeichnete Erzählung entmythologisiert betrachtet.
Ansätze Luthers, der bspw. das Fasten in seinen Predigten über Mt 4,1-11 thematisiert, müssen hier außen vor bleiben.
Dann folgen zwei Entwürfe mit Gedanken für die Ausfertigung längerer Predigten.
- Der erste sehr kurze Entwurf richtet sich an eine offene Zielgruppe. Absichtlich werden religiöse Begriffe auf das notwenige Maß beschränkt, um zu verhindern, dass Adressaten, die nicht religiös sind, die Inhalte vorschnell ablehnen.
- Der zweite Entwurf richtet sich sehr viel stärker an Christen, die sich dem Wort Gottes grundsätzlich nicht verschließen.
Beide Entwürfe folgen eher einem Ansatz, der von der existentialen Theologie ausgeht.
1. Eine heilsgeschichtliche Auslegung
Unter den Aspekten einer Theologie der Hoffnung und der Eschatologie könnte Matthäus 4,1-11 in einem größeren heilsgeschichtlichen Zusammenhang betrachtet werden.
Die Wüste als Ort der Entscheidung
Vorausgesetzter Gedanke: Gott handelt in der Geschichte und bewegt die Welt auf eine Zukunft hin.
Dann ist in der Perikope die Wüste kein Ort der Verlassenheit, sondern der Entscheidung: Wählt Jesus den Weg der Macht oder den Weg des leidenden Gottesknechts?
Die Versuchung der Macht und das Reich Gottes
Jesu Widerstand gegen den Teufel zeigt, dass das Reich Gottes nicht durch Zwang oder irdische Herrschaft kommt, sondern durch Liebe und Hingabe.
In der dritten Versuchung (Anbetung des Teufels für die Weltherrschaft) lehnt Jesus ab, das Reich Gottes mit den Mitteln dieser Welt aufzurichten. Hier könnte Kritik an politischen und kirchlichen Machtstrukturen entfalten.
Kreuz statt Spektakel – der Weg der Erniedrigung
Eine Theologie, die das Kreuz betont, betont, dass sich Gottes Herrlichkeit gerade in der Ohnmacht Jesu zeigt.
So könnte Jesus zwar vom Tempel springen und Gottes Schutz demonstrieren, aber das wäre ein Gott der Macht, nicht der Liebe.
Stattdessen führt sein Weg ans Kreuz – und genau dort offenbart sich Gott.
Eschatologische Hoffnung und Befreiung
Die Versuchungsgeschichte ist als Hinweis auf den Weg der Befreiung zu verstehen.
So widersteht Jesus, weil er auf Gottes Zukunft vertraut. Das gibt Hoffnung: Auch wir sind nicht Gefangene der Versuchungen dieser Welt, sondern leben in Erwartung der kommenden Gerechtigkeit Gottes.
Zusammenfassung
Matthäus 4,1-11 könnte also also nicht nur als persönliche Prüfung Jesu gesehen werden, sondern als grundsätzliche Entscheidung eines jeden Menschen für das Reich Gottes jenseits von Macht, Spektakel und Zwang. Die Geschichte ruft dazu auf, nicht auf Machbarkeit, sondern auf Gottes verheißene Zukunft zu vertrauen.
2. Eine politisch-sozialgeschichtliche Interpretation
Eine politisch-sozialgeschichtliche Theologie kann die Versuchung Jesu aus der Perspektive der sozialen Gerechtigkeit und der Unterdrückungserfahrung lesen. Dabei geht es um die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die hinter biblischen Texten stehen. Zu entfalten wäre, wie Machtkritik dann Hoffnung für Unterdrückte ausdrücken kann.
1. Die Wüste als Ort der Marginalisierten
Die Wüste ist in der Bibel oft ein Ort der Bewährung – aber auch der Ort der Armen und Ausgeschlossenen.
Jesus identifiziert sich in seiner Fastenzeit nicht mit den Reichen und Mächtigen, sondern mit den Hungrigen, den Benachteiligten.
So richtet sich diese Geschichte an Menschen, die Unterdrückung erfahren – und ihnen Hoffnung gibt.
2. Die drei Versuchungen als Kritik an Herrschaft und Ungerechtigkeit
Brot aus Steinen (Soziale Gerechtigkeit)
Der Teufel fordert Jesus auf, Steine in Brot zu verwandeln – eine Kritik an ungerechten Wirtschaftsstrukturen, die Arme hungern lassen.
Jesus verweigert sich dem schnellen Wunder – stattdessen fordert er eine gerechte Gesellschaft, in der alle genug zu essen haben. Es genügt nicht, Brot zu bekommen, wie auch Tiere im Zoo Nahrung zugeworfen bekommen, damit sie nicht verhungern. Genug Nahrung für alle zu haben ist eine gesellschaftliches Aufgabenstellung. Spontane Maßnahmen (wie Steine zu Brot machen) lindern zwar die akute Not, lösen aber die Probleme gerechter und zuverlässiger Nahrungsversorgung nicht.
Springen vom Tempel (Missbrauch von Religion)
Der Tempel steht symbolisch für das religiöse Establishment – und für eine Theologie, die Gott zum Machterhalt missbraucht.
Jesus weist diese Instrumentalisierung Gottes zurück: Wahrer Glaube setzt nicht auf Spektakel und Macht, sondern auf Vertrauen.
Dies war bereits ein bedeutender Ansatz Luthers für seine reformatorischen Ideen.
Macht über die Welt (Imperiale Herrschaft)
Der Teufel bietet Jesus politische Herrschaft an – eine Anspielung auf die Unterdrückung durch das Römische Reich.
Jesus lehnt dies ab und zeigt: Das Ziel für wahre Macht liegt nicht in Herrschaft, sondern im Dienst an den Menschen.
3. Fazit: Widerstand gegen ungerechte Verhältnisse
Die Geschichte kann Unterdrückte und Benachteiligte ermutigen: Nicht die Mächtigen der Welt haben das letzte Wort, sondern Gottes Gerechtigkeit.
Die Jüngerinnen und Jünger Jesu sind herausgefordert, sich für eine gerechtere Welt einzusetzen – und der Versuchung der Macht zu widerstehen.
Zusammenfassung
Als eine politische und sozialethische Erzählung zeigen die Versuchungen Jesu die Verführungen der Macht, der Religion und der ungerechten Wirtschaft. Jesus wählt nicht den Weg der Macht und des schnellen Erfolgs, sondern den Weg der Solidarität mit den Armen und der Treue zu Gott. Diese Geschichte ruft Christen dazu auf, sich gegen Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch zu stellen.
3. Eine existentiale, entmythologisierte Interpretation
Vorausgesetzter Gedanke: Matthäus 4,1-11 ist nicht als historisches Ereignis, sondern als theologische Aussage über die menschliche Existenz und den Glauben zu verstehen.
Die Versuchung als existentielle Herausforderung
Die Versuchung Jesu ist ein Bild für die Grundentscheidung des Menschen: Vertraue ich auf Gott oder auf meine eigene Sicherheit und Macht?
Die drei Versuchungen als Symbol für das menschliche Dasein
Brot aus Steinen (Versuchung des Materiellen)
Der Mensch sucht Sicherheit in materiellen Dingen, doch wahres Leben kommt aus dem Wort Gottes.
Springen vom Tempel (Versuchung des Spektakulären)
Der Mensch will Kontrolle über sein Leben und fordert Beweise von Gott – doch Glaube bedeutet Vertrauen ohne Beweise.
Macht über die Welt (Versuchung der Herrschaft)
Der Mensch strebt nach Macht, aber wahre Freiheit liegt in der Hingabe an Gott.
Entmythologisierung
Der Teufel als Symbol für die innere Zerrissenheit
Der Teufel ist nicht als persönliche Gestalt zu verstehen, sondern als Bild für die Spannung im Menschen zwischen Glaube und Unglaube.
Der Mensch steht immer wieder vor der Entscheidung: Folge ich dem Weg des Vertrauens oder dem Weg der Selbstbehauptung?
Der Glaube als Entscheidung
Im Glauben geht es nicht um äußere Wundertaten, sondern um eine radikale Entscheidung: Lebe ich aus dem Vertrauen auf Gott oder aus Angst?
Jesus zeigt den Weg des Vertrauens – und dieser Weg wird am Kreuz vollendet.
Zusammenfassung
Matthäus 4,1-11 kann als symbolische Erzählung über die Grundfragen des Menschseins verstanden werden: Sicherheit, Kontrolle, Macht – oder Vertrauen auf Gott? Die Versuchungsgeschichte ruft den Menschen dazu auf, sich existenziell auf Gott einzulassen, statt sich an Sicherheiten dieser Welt zu klammern.
Kleiner Entwurf für eine Predigt
Version 1
Evangelium nach Matthäus
Kapitel 4, Verse 1-11
Taufe und Versuchung Jesu
Die Versuchung Jesu
Die Kraft, Nein zu sagen
An Dich!
Stell dir vor: Du bist hungrig, allein, schwach – und dann kommt jemand, der dir genau das bietet, was du gerade brauchst. Klingt gut, oder? Genau das passiert Jesus in der Wüste. Doch was tut er? Er sagt Nein. Warum?
Weil diese Versuchungen nicht wirklich Freiheit bringen. Brot, Macht, Ansehen – all das verspricht schnelle Erleichterung, aber auf Kosten von Vertrauen und Integrität.
Und genau hier wird’s spannend: Diese Geschichte geht nicht nur um Jesus. Sie zeigt uns, wie wir in unseren eigenen Wüstenmomenten bestehen können. Wir haben die Freiheit, Nein zu sagen – zu falschen Kompromissen, zu Dingen, die sich gut anfühlen, aber nicht gut für uns sind.
Der Clou: Es geht nicht um religiöse Regeln, sondern um innere Stärke. Um die Entscheidung, dem zu folgen, was wirklich zählt – Vertrauen, Liebe, Echtheit.
Die Wüste lehrt uns: Wahre Stärke zeigt sich nicht im Machen, sondern im Widerstehen.
Kleiner Entwurf für eine Predigt
Version 2
Evangelium nach Matthäus
Kapitel 4, Verse 1-11
Taufe und Versuchung Jesu
Die Versuchung Jesu
Die Entscheidung im Angesicht der Versuchung
An Dich!
Die Geschichte der Versuchung Jesu in der Wüste ist kein Bericht über ein historisches Ereignis, sondern eine existenzielle Botschaft. Sie will uns heute ansprechen – dich und mich, hier und jetzt.
Schaut man sich die Texte der Bibel genauer an, stellt man schnell fest: Die Bibel spricht oft in Bildern, in Mythen. Aber hinter diesen Bildern steht eine Wahrheit über unser Leben.
Die Versuchung Jesu ist die Versuchung jedes Menschen. Sie zeigt: Wie entscheiden wir uns? Wofür leben wir? Wem vertrauen wir?
Ich möchte einige wenige Gedanken aufgreifen, die uns helfen können, zu verstehen, was dieser Text für uns heute bedeutet.
1. Die Wüste als Ort der Entscheidung
Die Wüste steht nicht nur für einen geografischen Ort, sondern für die Einsamkeit, in der wir auf uns selbst zurückgeworfen werden. Jeder von uns erlebt Momente der inneren Wüste: Zeiten der Unsicherheit, des Zweifels, des Alleinseins.
In solchen Momenten müssen wir Entscheidungen treffen. Die Frage ist: Wem vertrauen wir? Unseren Ängsten, dem Wunsch nach Sicherheit oder Bequemlichkeit? Oder vertrauen wir auf Gott, auch wenn der Weg schwierig bleibt?
2. Die Versuchungen als Spiegel unseres Lebens
Die drei Versuchungen, die Jesus begegnen, sind auch unsere Versuchungen:
- »Mache diese Steine zu Brot« – Die Versuchung, unsere Bedürfnisse sofort zu befriedigen, ohne Rücksicht auf das, was wirklich notwendig ist.
- »Stürz dich hinab, Gott wird dich retten« – Der Drang, Gott als eine Art Wunscherfüller zu missbrauchen.
- »Alle Reiche der Welt will ich dir geben« – Die Verlockung der Macht, des Erfolgs, des Ansehens.
Da stellen sich Fragen, wie: »Was bestimmt dein Handeln? Lebst du im Vertrauen auf Gott – oder suchst du Sicherheiten, die nur scheinbar Halt geben?«
3. Glaube als existenzielle Entscheidung
Jesus widersteht der Versuchung nicht, weil er göttliche Kräfte hat, sondern weil er im Vertrauen auf Gottes Wort lebt.
Auch unser Glaube ist immer eine Entscheidung – eine existentielle Entscheidung, die täglich neu getroffen werden muss.
Diese Entscheidung bedeutet, der Stimme Gottes in unserem Herzen zu folgen – auch wenn das bedeutet, auf kurzfristige Erleichterung oder Macht zu verzichten.
Schlussgedanke: Die Freiheit, Nein zu sagen
Die Versuchungsgeschichte zeigt uns: Wir sind längst nicht in jedem Fall Opfer unserer Umstände. Wir haben die Freiheit, Nein zu sagen – zu den falschen Sicherheiten, zu den leichten Lösungen, die uns in die Irre führen, zu Verführungen, denen wir so gerne folgen würden, die uns aber doch eher belasten denn befreien würden.
Aber was kann helfen? Woran können wir uns bei Entscheidungsfindungen orientieren? Gibt es so was wie Leitlinien dazu?
Ja, die gibt es. Es ist das Wort Gottes.
Im Text heißt es: »Der Mensch wird nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.« (Mt 4,4)
Im Vertrauen darauf können wir Krisen oder einem Entscheidungsnotstand oder emotionalen »Wüsten« standhalten. Wir haben etwas an der Hand, im Herzen und im Sinn, an dem wir uns festhalten können, etwas, was uns leiten kann.
Es liegt an uns, wie wir Entscheidungen im Angesicht von Versuchungen treffen und ob wir bereit sind, dafür dem Wort Gottes zu vertrauen.
| Perikope | Typ | Tag |
|---|---|---|
| 1531 - 1898 | ||
Mt 4,1-11 | Evangelium | |
| 1899 - 1978 | ||
Mt 4,1-11 | Evangelium | |
| Lutherische Kirchen 1958-1978 | ||
Mt 4,1-11 | Evangelium + | |
| 1979 - 2018 | ||
Mt 4,1-11 | Evangelium + | |
| seit 2019 | ||
Mt 4,1-11 | Evangelium + | |
Hörbuch-Videos zur Biblia 1545
 Übersicht der Hörbuch-Videos
Übersicht der Hörbuch-Videos
Frakturschrift ist nicht leicht zu lesen. Die Videos zeigen ausgewählte Texte aus der Lutherbibel von 1545, vorgelesen von Reiner Makohl.
Zum Gebrauch
Die Lutherbibel von 1545 ist mit ihrem Frakturzeichensatz nicht leicht zu lesen. Wir bieten Videos, in denen ausgewählte Perikopen aus den Sonn- und Feiertagsreihen vorgelesen werden.
Wir empfehlen, die Videos im Vollbildmodus zu genießen.
Credits zum Video:
©2024 by Reiner D. Makohl | www.stilkunst.de
Bibeltexte: Dr. Martin Luther, Biblia, Wittenberg 1545
Zeichensätze der Frakturschriften, Typografie & Layout,
Video: Reiner D. Makohl
Sprecher: Reiner D. Makohl
Musik: ©Bluevalley, J.S.Bach, Präludium in C-Dur, Gitarre
.png)