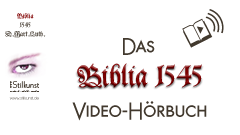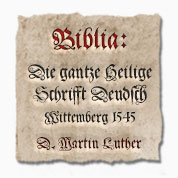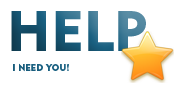Matthäus 17,1-9
Das Hörbuch-Video zur Lutherbibel von 1545
Hörbuch-Video zur Lutherbibel von 1545
Hörbuch-Video
Das Wirken Jesu in Galiläa
Die Verklärung Jesu
Evangelium nach Matthäus
17,1-9
vorgelesen von Reiner Makohl
Gedanken zum Text
Evangelium nach Matthäus
Kapitel 17, Verse 1-9
Das Wirken Jesu in Galiläa
Die Verklärung Jesu

Grafik: »Die Trasfiguration Jesu«
Petrus, Jakobus und Johannes erleben die Vision der Verklärung Jesu, in der neben Jesus Moses und Elia erscheinen (Mt 17,1-9).
Die Grafik basiert auf einem Foto eines Gemäldes von Carl Heinrich Bloch (1834-1890).
Quelle und Lizenzverweise: siehe Wikimedia Commons
©public domain | für www.stilkunst.de adaptiert by Reiner Makohl
Einleitung
Der Inhalt
Der Text Mt 17,1-9 ist schwierig. In der dort erzählten Verklärung Jesu offenbart sich Jesus in göttlicher Herrlichkeit auf einem Berg. Mose und Elia erscheinen, und eine Stimme aus der Wolke spricht: »Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; auf ihn sollt ihr hören!«
Der Text belegt gleich durch drei Zeugen die göttliche Herkunft Jesu. Angeführt werden Moses, Elia und »eine Stimme aus einer Wolke«.
Anwesend sind aus dem Kreis der Jünger Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes.
Petrus reagiert überraschend nüchtern. Er wundert sich nicht darüber, dass er ganz klar Moses und Elia erkennt. Er bietet an, an diesem Ort drei Hütten zu bauen, damit Moses, Elia und Jesus auf dem Berg nächtigen können, falls das Gespräch länger dauert. Petrus vermittelt damit, dass das Geschehen selbstverständlich ist und keiner Erklärung bedarf.
Doch dann sind plötzlich Moses und Elia fort. Jetzt erschallt die Stimme aus der Wolke, und erst jetzt erschrecken die Jünger darüber.
Jesus erklärt offensichtlich, dass die Jünger eine »Vision« erlebt hatten. Denn als die kleine Gruppe schließlich vom Berg absteigt, ermahnt sie Jesus, dass sie niemanden von dieser Vision erzählen sollen bis nach der Auferstehung Jesu.
Enstehungszeit der Geschichte
Der Text erklärt, dass diese Geschichte zu Jesu Lebzeiten nicht bekannt gewesen sei. Außer Petrus, Jakobus und Johannes wusste niemand davon, niemand erzählte darüber. Erst nach dem Tod und der Auferstehung Jesu formte sich irgendwann diese Geschichte. Ein genauer Zeitpunkt kann nicht ausgemacht werden. Die Erzählung muss auch Petrus, Jakobus oder Johannes zurückgehen.
Problematische Erzählungsteile
Das wirft Fragen auf. Was war es, was da geschah? War es reales Geschehen? Oder war es eine Vision? Trug sich alles ganz anders zu? War die Erzählung nötig, um Jesus gegenüber Zweiflern als Messias auszuweisen? Dienten die »Zeugen« Moses und Elia genau diesem Zweck? Speziell gegenüber jüdischen Zuhörern?
Durch die Gegenwart von Moses und Elia wird Jesus als der erwartete Messias einwandfrei bestätigt. Durch den Satz, den die Stimme aus der Wolke spricht, wird Jesus zusätzlich als Sohn Gottes bestätigt.
Die Aussage einer Stimme vom Himmel, dass Jesus Gottes sei, ist bereits aus dem Taufgeschehen bekannt. Der Zusatz »Auf den sollt ihr hören!« weist Jesus zweifelsfrei als jenen aus, dessen Lehren und Gebote höher stehen als die Gesetze Mose und Prophetien des Elia.
Interpretation und Auslegung
Die Geschichte lässt sich für uns nicht wirklich fassen. Aber es gibt zahlreiche Auslegungen dazu, die aus völlig unterschiedlichen Perspektiven die Geschichte beleuchten, um für uns heute daraus Botschaften zu extrahieren, deren Anliegen es ist, uns zu helfen, damit den Glauben an Gott zu vertiefen.
Zeitgenössische Auslegungen
Zeitgenössische Theologen nähern sich der Verklärung Jesu in Matthäus 17,1-9 aus vielfältigen Perspektiven, die von biblischer Exegese über systematische Theologie bis hin zu ethischer und spiritueller Anwendung reichen. Versucht man die Zugänge zu strukturieren, lassen sich einige wesentliche Überlegungen herausarbeiten:
Die biblisch-theologische Perspektive:
Verbindung von Altem und Neuem Testament
Moderne Exegeten betonen häufig die theologische Bedeutung der Verklärung als Bindeglied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Mose und Elia symbolisieren das Gesetz und die Propheten, deren Verheißungen in Jesus erfüllt werden. Die Stimme aus der Wolke weist darauf hin, dass Jesus nicht nur in dieser Tradition steht, sondern sie übertrifft.
Zeitgenössische Deutung:
Jesus wird als der endgültige Offenbarer Gottes verstanden, der die alttestamentlichen Verheißungen auf sich selbst konzentriert. Die Verklärung lädt ein, die Schrift in der Gesamtheit als Zeugnis auf Christus hin zu lesen.
Die christologische Perspektive:
Die göttliche und menschliche Natur Jesu
Die Verklärung wird oft als Moment der Offenbarung der göttlichen Natur Jesu interpretiert. Zeitgenössische Theologen, insbesondere in ökumenischen Kontexten, betonen jedoch auch die Untrennbarkeit der menschlichen und göttlichen Natur Jesu. Der Text offenbart die Identität Jesu, ohne sein Leiden und seine Menschlichkeit zu leugnen.
Zeitgenössische Deutung:
Die Verklärung erinnert daran, dass der Glaube an Jesus die Spannung zwischen Herrlichkeit und Leid umfasst. Gottes Offenbarung geschieht mitten in der menschlichen Realität und zeigt einen Gott, der auch in Leid und Kreuz gegenwärtig ist.
Die Spiritualität und mystische Theologie:
Der Berg als Ort der Gotteserfahrung
Mystische und spirituelle Ausleger sehen in der Verklärung ein Vorbild für die christliche Kontemplation. Der Berg steht symbolisch für Momente der Nähe Gottes, die Glanz und Tiefe des Glaubens offenbaren. Diese Erfahrungen ermutigen dazu, nach Zeiten der Stille und Nähe Gottes in die alltägliche Welt zurückzukehren.
Zeitgenössische Deutung:
Die Verklärung ruft dazu auf, spirituelle Erfahrungen zu suchen und zuzulassen, dabei jedoch nicht in Isolation zu verharren. Die Jünger mussten den Berg verlassen und in die Welt zurückkehren – eine Erinnerung daran, dass christliche Spiritualität immer auf die Welt hin orientiert ist.
Ethik und Nachfolge: Das Hören auf Jesus
Die göttliche Stimme, die zur Nachfolge aufruft – „Auf ihn sollt ihr hören!“ – wird von zeitgenössischen Theologen als ein zentraler ethischer Appell verstanden. In einer pluralistischen Welt bedeutet das Hören auf Jesus, ihn als Orientierungspunkt für die Liebe zu Gott und zum Nächsten zu sehen.
Zeitgenössische Deutung:
Der Text fordert dazu auf, Jesu Worte ernst zu nehmen und sie in der gelebten Praxis umzusetzen. Dies betrifft sowohl individuelle ethische Entscheidungen als auch gesellschaftliches Engagement für Gerechtigkeit und Versöhnung.
Ökologische und politische Perspektiven:
Hoffnung und Transformation
In der heutigen Theologie finden sich zunehmend auch politische und ökologische Deutungen. Die Verklärung wird als Symbol für Transformation und Hoffnung interpretiert – eine Einladung, die Welt durch die Augen des Reiches Gottes zu sehen und sich für dessen Verwirklichung einzusetzen.
Zeitgenössische Deutung:
Die Verklärung ermutigt, nicht nur auf individuelle Erlösung zu hoffen, sondern die Herrlichkeit Gottes in der Welt sichtbar zu machen – durch Einsatz für Schöpfungsbewahrung, Frieden und soziale Gerechtigkeit.
Evangelische Schwerpunkte
Für die Auslegung sind einige wenige Schwerpunkte von zentraler Bedeutung:
- Jesus ist der verheißene Retter: Die Anwesenheit von Mose (Gesetz) und Elia (Propheten) zeigt, dass Jesus die Erfüllung der Verheißungen des Alten Testaments ist.
- Gott offenbart sich: Die Stimme aus der Wolke bezeugt Jesu göttliche Sohnschaft. Gott selbst fordert dazu auf, auf Jesus zu hören – er ist das Zentrum unseres Glaubens.
- Das Reich Gottes ist Gegenwart: Die Jünger erleben Gottes Herrlichkeit unmittelbar in ihrer Gegenwart. Die Verklärung zeigt: Das Reich Gottes ist für uns im Hier und Jetzt erfahrbar, erlebbar und gestaltbar. Seine Vollendung liegt (noch) in weiter Ferne, doch wir haben bereits heute teil daran.
Zusammenfassung
Zeitgenössische Theologen interpretieren Matthäus 17,1-9 auf vielfältige Weise – christologisch, spirituell, ethisch und sozial.
Gemeinsam ist vielen Ansätzen, dass die Verklärung Jesu als ein Ruf verstanden wird, in der Nachfolge Jesu zu leben, dabei sowohl die Herrlichkeit Gottes als auch den Weg des Leidens und der Hingabe anzuerkennen. Der Text inspiriert dazu, Gottes Gegenwart in der Welt zu erkennen und aktiv am Aufbau des Reiches Gottes mitzuwirken.
Unsere Position in einer Theologie der Wertschätzung und der Entmythisierung der Offenbarung Gottes
Theologische Positionen von namhaften evangelischen Theologinnen und Theologen wie beispielsweise Karl Barth, Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer, Jürgen Moltmann, Luise Schottroff, Wolfhart Pannenberg, Eberhard Jüngel, Dietrich Ritschl, Hans Küng, Michael Welker, Margot Käßmann u.a. haben recht unterschiedliche Zugänge zu diesem Textstück ermöglicht – exegetisch, systematisch-theologisch, biblisch-hermeneutisch und pastoral – und haben zur reichen Vielfalt an Interpretationen von Matthäus 17,1-9 beigetragen. Ihre Gedanken beeinflussen die Predigt, die Lehre und die praktische Spiritualität darüber.
All das erscheint eher verwirrend als helfend, geht es uns doch darum: Was fange ich damit heute an als Mensch in jener Welt, die uns faktisch und real umgibt.
Auslegungen, die sich an moderne Menschen richten, können nicht von »Verklärung« sprechen, also von einem Wandel der Figur Jesus (»Transfiguration«) in ein Geistwesen.
Sie können nicht glaubhaft vermitteln, dass Moses und Elia, die schon damals seit langer Zeit Tod und deren Körper längst zu Staub verfallen waren, plötzlich erscheinen, in welcher Form auch immer. Solche Auslegungen können nicht ernstgenommen werden, wenn von »Vision« gesprochen wird, also von Halluzinationen, die wir im Zusammenhang mit krankhaften Geisteszuständen in schizophrenen Psychosen sehen oder schlicht mit Drogenmissbrauch verbinden.
Visionen sind anders als in antiken Denkwelten heute nicht positiv, sondern negativ konnotiert.
Es kann uns aber auch nicht gelingen, mehr »Wahrheitsgehalt« zu erzeugen, in dem wir antike mythische Aspekte in der Erzählung auflösen. Die Erzählung ist von ihrem Sinn und Zweck her betrachtet einfach als Zeugnis zu verstehen, das die Autoren mit gängigen Zeugen und Beurkundungen jener Zeit ausstatteten (Moses, Elia, Stimme) bis in eine haptische Ausschmückung hinein (Petrus will Hütten bauen), das von real existierenden Menschen beglaubigt sei (Petrus, Jakobus, Johannes).
Die Magie des Geschehens wird verstärkt durch die Geheimniswahrung der Geschichte sogar gegenüber den übrigen Jüngern Jesu bis nach dessen Auferstehung.
Der Text in der religiösen Praxis
Was nun? Uns bleibt nur, das Rasiermesser der Philosophie anzusetzen (nach »Ockhams Rasiermesser«), was dazu führen sollte, von all den vielen und sehr wohl möglichen Erklärungen die einfachste Theorie allen anderen vorzuziehen und unwahrscheinliche bzw. nicht erklärbare Auslegungen wegzurasieren.
Betrachten wir dafür die Faktenlage:
- Das Zeugnis: Der Text dient unzweifelhaft als Zeugnis dafür, dass Jesus der Messias und der Sohn Gottes ist.
(Moses und Elia bezeugen Jesus als den »Messias«, als Christus; die Stimme bezeugt Jesus als Sohn Gottes. ) - Die Bedeutung der Lehren Jesu: Moses, als Vertreter des Gesetzes, und Elia, als Vertreter der Propheten, sehen ihre Ziele und Vorstellungen in Jesus als Vertreter des göttlichen Willens vereint.
- Die Rangordnung der Lehrer: Jesus wird als religiöser Lehrer von der Stimme aus den Wolken über Moses und Elia gestellt.
- Die Aufforderung zum Gehorsam: Die Stimme verlangt bedingungslosen Gehorsam Jesus gegenüber. Seine Lehren stehen über den den Gesetzen des Mose und über den Lehren der Propheten. Die Lehren Jesu einzuhalten, auch dort, wo sie scheinbar mit dem Gesetz und den Propheten kollidieren, ist hochrangig zu erfüllen.
- Anthropozentrische Theologie und implizite Christologie: Die Aufforderung zum Gehorsam dem vorösterlichen Jesus und seiner Lehren gegenüber verlangt eine implizite Christologie, die sich an den den Menschen richtet, also anthropozentrischer Auslegung bedarf.
Fazit
Für die praktische Anwendung sagt der kurze Text genau das: Jesus ist der Messias, der Erlöser, auf dessen Lehren und Gebote zu hören ist in allen praktischen Situationen des gesellschaftlichen und religiösen Lebens.
Alles darüber hinaus ist eher verwirrend oder weltfremd oder praxisfern und trägt nichts zum Christsein eines modernen Menschen bei.
Insbesondere kann der Text nicht durch eine streng kerygmatische Theologie im Sinne Luthers, gar verbunden mit einer Christologie von oben, erschlossen werden. Das reformatorische »Allein aus Glauben« gilt selbstverständlich, doch darf es nicht missbraucht werden, um das Verklärungsgeschehen modernen Menschen als unerklärbare Erscheinung, als Vision göttlicher Präsens aufzuzwingen. Antike Kommunikationsstrategien und -methoden, die sehr stark von mythischen Vorstellungen geprägt sind, sind heute meist negativ konnotiert im Sinne von Sagen, Märchen und Legenden.
Kleiner Entwurf für eine Predigt
Evangelium nach Matthäus
Kapitel 17, Verse 1-9
Das Wirken Jesu in Galiläa
Die Verklärung Jesu
oder
Das Zeugnis des Mose, des Elia und Gottes über Jesus, den Messias
Hören auf das, was wichtig ist im Leben
An Dich!
Die Leute sprachen: »So, so! Ihr behauptet also, euer Jesus sei der Messias gewesen. Wir haben davon aber nichts gehört. Für uns ist wichtig, was Moses und Elia sagen!«
Da antworteten die Jünger: »Moses und Elia sind unsere Zeugen! Wisst ihr denn nicht, dass Jesus, als er noch unter uns lebte, auf einen Berg stieg und verklärt wurde? Sein Körper wurde wie die Gestalt eines Engels und helles Licht umgab ihn. Da kamen Moses und Elia und huldigten ihm. Und eine Stimme tönte donnernd aus den Wolken, die sprach: Dieser ist mein Sohn. Hört auf ihn!«
Die Leute antworteten: »Was erzählt ihr für Zeug? Hätten wir nicht davon hören müssen, als euer Jesus noch lebte? Das ganze Volk wäre ihm nachgelaufen, wäre es bekannt geworden, dass er der Christus ist.«
Die Jünger sprachen: »Ist das so? Er selbst wies Petrus, Jakobus und Johannes an, die dabei waren und alles sahen, niemandem vor seiner Auferstehung davon zu erzählen. Denn er fürchtete, dass ihn die Menschen sofort verfolgen, fangen und töten würden, weil ihm Moses und Elia dienten, und weil Gott die Menschen anwies, auf Jesus und seine Lehren zu hören. Doch seine Zeit war noch nicht gekommen.«
Und weiter sprachen sie zu den Leuten: »Ihr wisst doch, dass sich etliche Machthaber nicht über das Kommen des Messias gefreut hätten und bis heute nicht freuen würden. Und ihr wisst, dass etliche politische Gruppen völlig andere Erwartungen an ihn gehabt hätten. Sie hätten gewollt, dass er auf ihrer Seite steht und jeden bekämpft, der gegen sie ist. Doch in Wahrheit war er genau gegen jene, die ihn vereinnahmen wollten dafür, andere zu Opfern ihrer Gewalt und Machtbesessenheit zu machen.«
Da liefen die Leute kopfschüttelnd davon. Viele ärgerten sich über die Worte der Jünger. Andere schrien und wollten ihnen den Mund verbieten. Doch einige wenige blieben und hörten zu. Sie wollten mehr wissen. Und schließlich hörten sie nicht nur den Jüngern mit ihren wunderlichen Geschichten zu, sondern sie hörten auf die Lehren Jesu. Ganz so, wie es der Wille Gottes war und ist.
Denn die Leute erkannten, was wichtig ist im Leben.
| Perikope | Typ | Tag |
|---|---|---|
| 1531 - 1898 | ||
Mt 17,1-9 | Evangelium | |
| 1899 - 1978 | ||
Mt 17,1-9 | Evangelium | |
| Lutherische Kirchen 1958-1978 | ||
Mt 17,1-9 | Evangelium + | |
| 1979 - 2018 | ||
Mt 17,1-9 | Evangelium + | |
Mt 17,24-27 | Marginaltext | |
| seit 2019 | ||
Mt 17,1-9 | Evangelium + | |
Hörbuch-Videos zur Biblia 1545
 Übersicht der Hörbuch-Videos
Übersicht der Hörbuch-Videos
Frakturschrift ist nicht leicht zu lesen. Die Videos zeigen ausgewählte Texte aus der Lutherbibel von 1545, vorgelesen von Reiner Makohl.
Zum Gebrauch
Die Lutherbibel von 1545 ist mit ihrem Frakturzeichensatz nicht leicht zu lesen. Wir bieten Videos, in denen ausgewählte Perikopen aus den Sonn- und Feiertagsreihen vorgelesen werden.
Wir empfehlen, die Videos im Vollbildmodus zu genießen.
Credits zum Video:
©2024 by Reiner D. Makohl | www.stilkunst.de
Bibeltexte: Dr. Martin Luther, Biblia, Wittenberg 1545
Zeichensätze der Frakturschriften, Typografie & Layout,
Video: Reiner D. Makohl
Sprecher: Reiner D. Makohl
Musik: ©Bluevalley, J.S.Bach, Präludium in C-Dur, Gitarre
.png)