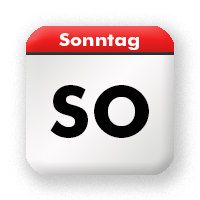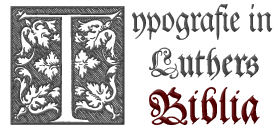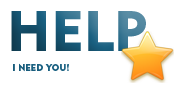Vierter Sonntag des Advent
Sonntag, 20. Dezember 1676

QuickInfo
Altkirchliche Ordnung
| Evangelium | |
| Epistel | |
| Lied | Nr. 7 [EG 9] |
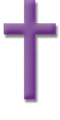
Das evangelische Kirchenjahr
Der vierte Sonntag des Advent in den Kirchenjahren 1676/1677 bis 1683/1684
Verweise führen zu den Kalenderblättern des jeweiligen Datums:

- Der frühest mögliche Termin für den 4. Advent ist der 18. Dezember. In diesem Fall wird Heiligabend ein Samstag sein.
- Der spätest mögliche Termin ist der 24. Dezember, dann fällt Heiligabend auf einen Sonntag, der zugleich der
 4. Adventssonntag ist.
4. Adventssonntag ist.

- Die
 Adventszeit umfasst die vier Sonntage vor dem
Adventszeit umfasst die vier Sonntage vor dem  Christfest. Sie beginnt immer am ersten Adventssonntag und endet vor der
Christfest. Sie beginnt immer am ersten Adventssonntag und endet vor der  Christvesper an
Christvesper an  Heiligabend. Dadurch ist sie unterschiedlich lang und kann 22 bis 28 Tage dauern.
Heiligabend. Dadurch ist sie unterschiedlich lang und kann 22 bis 28 Tage dauern. - Im Jahr 1677 ist die Aventszeit 27 Tage lang.

- Der vierte Sonntag im Advent liegt einen Tag bis 7 Tage vor dem Christfest.
- Der vierte Sonntag im Advent 1677 liegt 6 Tage vor dem Christfest.
Der Name Advent
Adventus Domini
Der Name Advent stammt aus dem Lateinischen und meint Ankunft (lat. adventus). Der vollständige lateinische Name lautet Adventus Domini ( »Ankunft des Herrn«) und bezeichnet die Jahreszeit, in der die Christenheit sich auf das Hochfest der Geburt von Jesus von Nazaret, auf Weihnachten, vorbereitet.
Die Christen gedenken der Geburt Jesu und feiern sie als Menschwerdung Gottes. Zugleich erinnert Advent daran, dass Christen das zweite Kommen Jesu Christi erwarten sollen.
Die Adventszeit
Praeparatio adventus Domini
Der lateinische Ausdruck praeparatio adventus Domini meint Vorbereitung der Ankunft des Herrn und bezeichnete bereits in der frühen Kirche das, was wir heute Adventszeit nennen.
Zunächst wurde die Adventszeit als Fastenzeit vor ![]() Epiphanias (6. Januar) bzw. vor Weihnachten verstanden. Vermutlich seit dem 6. Jahrhundert wird die Adventszeit auch liturgisch in Messfeiern begangen. Anfangs schwankte die Zahl der Tage und damit die Zahl der Sonntage in der Adventszeit. Erst im 6. Jahrhundert wurden vier Adventssonntage vor Weihnachten durch Papst Gregor dem Großen (540 - 604) festgelegt.
Epiphanias (6. Januar) bzw. vor Weihnachten verstanden. Vermutlich seit dem 6. Jahrhundert wird die Adventszeit auch liturgisch in Messfeiern begangen. Anfangs schwankte die Zahl der Tage und damit die Zahl der Sonntage in der Adventszeit. Erst im 6. Jahrhundert wurden vier Adventssonntage vor Weihnachten durch Papst Gregor dem Großen (540 - 604) festgelegt.
Während wir an dieser Stelle den 4. Adventssonntag aus der Sicht des evangelischen Kirchenkalenders beleuchten, finden Sie allgemeine Informationen und Gedanken in diesem Artikel:
Wissenswertes zum Tag
 4. Advent 1677
4. Advent 1677
Schenken und beschenkt werden, »sich auf den Weg machen«, um die Geschenke zu überbringen. Der Besuch drückt aus, wie groß Freude und Wertschätzung sind.
Gottesdienstliche Ordnung

Der evangelische
Vierter Sonntag
des Advent
Liturgische Farbe
Violett
Nach altkirchlicher Textordnung
überwiegend gültig in den Jahren 1530/1531 bis 1897/1898
Thema des Sonntags
( nach dem Episteltext Phil 4,4-7 )
Freut euch! Der Herr iſt nahe
Spruch und Psalm für die Woche
Meine Seele erhebt den HERRN. Vnd mein Geiſt frewet ſich Gottes meines Heilandes.
Die biblischen Texte für Lesung und Predigt
| Lesung | Predigttext | Text |
|---|---|---|
| Evangelium | im Hauptgottesdienst | |
| Epistel | im zweiten Gottesdienst | |
Erläuterungen zu den Perikopen
Mit der Reformation änderte sich die Bedeutung der Lesungen und der Predigt im Gottesdienst grundlegend. Gab es vorher keine oder nur eine sehr lose Bindung der Perikopen an die Messe, so war für Luther nun regelmäßig die Evangelienperikope Grundlage der Predigt im sonntäglichen Hauptgottesdienst (vormittags), an diesem Tag also ![]() Joh 1,19-28.
Joh 1,19-28.
Im Fokus der Predigt stand jetzt als Teil der Verkündigung die Auslegung des Evangeliums.
Die Epistelperikope war als Predigttext empfohlen für den Gebrauch im Gottesdienst am Nachmittag bzw. Abend (siehe dazu auch Luthers Schrift ![]() Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde, 1523, Über den Sonntagsgottesdienst).
Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde, 1523, Über den Sonntagsgottesdienst).
Die Reihe der Epistelperikopen enthielt (anders als heute) auch Texte aus dem Alten Testament. Es gab keine spezielle Reihe für Lesungen aus dem Alten Testament.
Doch die Pfarrer und Prediger waren zunächst nicht nur frei darin, einen biblischen Text für die Predigt zu wählen, sondern geradezu aufgefordert, die Predigt an den Bedürfnissen der Gemeinde und an der geübten Praxis auszurichten.
In den meisten Kirchen wurden nahezu täglich Gottesdienste geboten (die in unseren Kalendern z. Z. nicht abgebildet sind). An Sonn- und Feiertagen konnten gleich mehrere Gottesdienste und Messen stattfinden. Hier entwickelten sich Leseempfehlungen für jeden Wochentag, in Summe also für jeden Tag des Kirchenjahres.
Von Bedeutung war auch die protestantische Ausrichtung der Gebietskirche: lutherisch, reformiert (calvinistisch) und uniert. Unterschiede zeigten sich in der Liturgie und damit im Verständnis der Predigt als Teil der Verkündigung.
Luthers allgemeinen Empfehlungen in seinen Schriften folgten etwa ab 1560 vereinzelt Ansätze, eine gewisse verbindliche Textordnung für Pfarrer und Gemeinden zu gestalten. Dies geschah jedoch zaghaft und zögerlich angesichts der bestehenden Meinungsvielfalt und angesichts der Lage der Entscheidungshoheit, die nicht in der Kirche, sondern beim Landesfürsten angesiedelt war. Zunächst gab es auch keinen hinreichenden Bedarf für neue Regelungen: Gottesdienst war selbstverständlich und die Bevölkerung nahm rege teil. Doch spätestens im Zeitalter der Aufklärung, als ein deutlicher Rückgang christlichen Engagements in der Bevölkerung zu erkennen war, die Zahl der Gottesdienstbesucher stetig abnahm und etliche unterwöchige Gottesdienste und Messen gestrichen wurden, trat die Notwendigkeit deutlich hervor, das Gottesdienstverständnis und die Gottesdienste des Kirchenjahres zu überdenken.
Dies führte vielfach schon früh und speziell im 19. Jahrhundert zu zahlreichen unterschiedlichen Durchführungen, Vorschlägen und Erprobungen, bis sich 1896 die Eisenacher Konferenz als reichsweite Konferenz der deutschen Landeskirchen mit der Idee einer allgemein gültigen Textordnung beschäftigte und schließlich eine Perikopenordnung beschloss, die ab 1898/1899 allen evangelischen Landeskirchen zur Umsetzung empfohlen wurde.
Es ist derzeit an dieser Stelle nicht möglich, für die Jahre 1530/1531 bis 1898/1899 Textordnungen darzustellen, die über die altkirchlichen Perikopen für die Lesungen und Predigten hinaus gehen. Wir sind uns dabei bewusst, dass diese Perikopen regional und zeitlich begrenzt keine Bedeutung hatten.
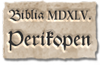
Perikopen nach Luther 1545
Vierter Sonntag des Advent
Perikopen
Texte für Lesungen und Predigt
Gültig in den Kirchenjahren bis 1897/1898
Die Leittexte aus den Evangelien und den Episteln
nach altkirchlicher Perikopenordnung
Text nach der Lutherbibel von 1545 gesetzt nach der Vorlage des Originals in Frakturschrift mit Luthers Scholion in den Marginalspalten.
Ergänzt um Verszählung und Abschnittsüberschriften.
LESUNG UND PREDIGTTEXT
Evangelium
Evangelium nach Johannes
Joh 1,19-28
REIHE
EV

Euangelium
S. Johannes.
C. I.
VND dis iſt das zeugnis Johannis / Da die Jüden ſandten von Jeruſalem Prieſter vnd Leuiten / das ſie jn fragten / Wer biſtu? 20Vnd er bekandte vnd leugnet nicht / vnd er bekandte / Ich bin nicht Chriſtus. 21Vnd ſie fragten jn / Was denn? Biſtu Elias? Er ſprach / ich bins nicht. Biſtu ein Prophet? Vnd er antwortet / Nein. 22Da ſprachen ſie zu jm / Was biſtu denn? Das wir antwort geben / denen / die vns geſand haben. Was ſageſtu von dir ſelbs? 23Er ſprach / Ich bin eine ſtimme eines Predigers in der Wüſten / Richtet den weg des HERRN / wie der Prophet Iſaias geſagt hat.
24VND die geſand waren / die waren von den Phariſeern. 25Vnd fragten jn / vnd ſprachen zu jm / Warumb teuffeſtu denn / ſo du nicht Chriſtus biſt / noch Elias / noch ein Prophet? 26Johannes antwortet jnen / vnd ſprach / Ich teuffe mit waſſer / Aber er iſt mitten vnter euch getretten / den jr nicht kennet. 27Der iſts / der nach mir komen wird / welcher vor mir geweſen iſt / Des ich nicht werd bin / das ich ſeine Schuchriemen aufflöſe. 28Dis geſchach zu Betharaba jenſeid des Jordans / da Johannes teuffet.
![]()
![]()
![]()
✽
1) lat.: ut mysterium consonet.
dt.: »damit das Mysterium übereinstimme.«
Luther gibt an, dass in Vers 28 seine Übersetzung Betharaba auch mit Bethbara wiedergegeben werden könne. Dieser Name taucht im Buch der Richter auf (![]() Ri 7,24). Dies geschehe dann in der Absicht, die beiden geheimnisvollen, unklaren Ortsangaben in Übereinstimmung zu bringen.
Ri 7,24). Dies geschehe dann in der Absicht, die beiden geheimnisvollen, unklaren Ortsangaben in Übereinstimmung zu bringen.
LESUNG UND ZWEITER PREDIGTTEXT
Epistel
Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi
Phil 4,4-7
REIHE
EP

Die Epiſtel S. Pauli:
An die Philipper.
C. IIII.
Verse 4 - 7
Verkündigung, Dank und Gebet als Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi
Paulus schreibt:
FRewet euch in dem HErrn allwege / vnd abermal / ſage ich / frewet euch. 5Ewer Lindigkeit laſſet kund ſein allen Menſchen. Der HErr iſt nahe.6Sorget nichts / Sondern in allen dingen laſſet ewre Bitte im Gebet vnd Flehen / mit Danckſagung fur Gott kund werden. 7Vnd der friede Gottes / welcher höher iſt / denn alle vernunfft / beware ewre hertzen vnd ſinne in Chriſto Jheſu.
![]()
✽
»Frewet euch mit den Frölichen /
vnd weinet mit den Weinenden.
Habt mit allen Menſchen Friede.«
Zum Gebrauch
Der Rückblick auf die Perikopenordnungen vergangener Jahrhunderte zeigt auf, wie sich die Verwendung der biblischen Texte in evangelischen Gottesdiensten im Laufe der Zeit veränderte.
Wir beschränken uns in den weit zurückliegenden Jahren auf Perikopenordnungen, die überwiegend in Gebrauch waren.
Durch die neue Ordnung für die Verwendung von Sprüchen, Psalmen, Bibeltexten und Liedern in Gottesdiensten sind die alten Ordnungen zwar liturgisch überholt, aber inhaltlich deswegen keineswegs falsch.
Wir möchten Sie daher ermuntern, die in alter Zeit verwendeten Perikopen zu betrachten. Nur so können Sie ergründen, ob das, worauf sich Pfarrer vor Hunderten von Jahren in Gottesdienst und Predigt stützten, auch noch heute aktuell ist. Aktuell für Sie ganz persönlich.

™Hinweise zur Stilkunst.de-Ausgabe
Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Bibeltextes
Der Text aus der Lutherbibel ist auf unseren Seiten in Anlehnung an das Druckbild des Originals von 1545 wiedergegeben.
Den Seitenaufbau, die verwendeten Schriften, die Schreibregeln der Frakturschrift und Luthers Intentionen, mit der Typografie Lesehilfen bereitzustellen, erläutert dem interessierten Leser unser Artikel »Satz und Typografie der Lutherbibel von 1545«.
Wissenswertes
 Heiligabend am 4. Advent
Heiligabend am 4. Advent
Heiligabend am 4. Advent? Zwei kirchliche Feste am selben Tag? Wie geht das? Und wieso ist Heiligabend immer an einem anderen Wochentag?
In diesem Artikel wird es erklärt.
Wissenswertes zum Tag
 4. Advent 1677
4. Advent 1677
Schenken und beschenkt werden, »sich auf den Weg machen«, um die Geschenke zu überbringen. Der Besuch drückt aus, wie groß Freude und Wertschätzung sind.